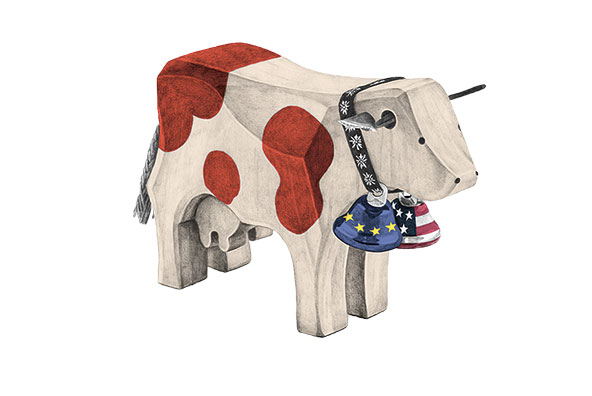Der Präsident des Bauernverbands, Markus Ritter, und der ehemalige WTO-Chefunterhändler Luzius Wasescha auf dem Dach des Hotels Schweizerhof in Bern. (Bild: Seco, Marlen von Weissenfluh)
Auf der Zugfahrt von Luzern nach Bern habe ich jüngst auf einem Feld ein Plakat mit der Aufschrift «Stop TTIP» gesehen. TTIP steht für das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. Was tut die Schweiz, wenn sich ihre wichtigsten Handelspartner einigen sollten?
Luzius Wasescha: Ob es so weit kommt, ist noch ungewiss. Das brächte jedoch Herausforderungen für die Landwirtschaft mit sich. Wenn die Franzosen, die Holländer, die Italiener und die Spanier zollfreien Käse in die USA liefern, dann wird es schwierig für die Exporteure. Die Schweiz müsste also ein Andocken an das TTIP anstreben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere Freunde in Brüssel gar nicht begeistert wären, wenn die Schweiz hier zu einem Billigtarif mitmachen könnte.
Markus Ritter: Der Bauernverband geht das Ganze pragmatisch an: Wir schauen, was kommt, und dann beurteilen wir das. Ist der Abschluss auch für uns vorteilhaft, unterstützen wir das Ergebnis – und sonst lehnen wir es ab.
In Europa sind die Ängste vor diesem Abkommen gross.
Wasescha: Die Kritiker befürchten, finstere Mächte würden hinter dem Rücken der Leute in geheimen Verhandlungen etwas beschliessen, das dann auch bei uns das Leben total veränderte. Sie fordern zudem grössere Transparenz in den Verhandlungen.
Abgesehen vom Vorwurf der geheimen Verhandlungen beunruhigen «Chlorhühner», genmanipulierter Mais und mangelnde ökologische Normen die Menschen.
Ritter: Die Frage ist, was effektiv in das TTIP-Abkommen hineinkommt. Käme alles rein, was die Amerikaner heute in der Agrarpolitik machen, dann würde das europäischen Grundwerten fundamental widersprechen. Bei den Amerikanern ist alles noch in Ordnung, was für den Konsumenten nicht giftig ist. Wir hingegen achten sehr stark auf einen nachhaltigen Produktionsprozess. Ökologische, soziale Standards und die Produktionsmethoden selber, der Schutz der Natur und der Ressourcen: Solche Begriffe lösen bei den Amerikanern ein müdes Lächeln aus. Für sie ist das Zeitverschwendung, die höchstens ihre Produktivität eindämmt und die Kosten in die Höhe treibt.
Wie stehen die Chancen auf eine Einigung in den Kernpunkten?
Wasescha: Ich könnte mir vorstellen, dass man ein Rahmenabkommen verabschiedet, das die Grundpfeiler festschreibt. Die Inhalte verschiebt man auf später. Ob dann jedoch eine neue demokratische oder republikanische US-Regierung damit weiterfahren würde, ist offen. Auch auf europäischer Seite gibt es Fragezeichen. Nicht nur das EU-Parlament müsste das Abkommen gutheissen, sondern auch die Mitgliedstaaten. Und das kann dauern.
Wie sehen Sie das, Herr Ritter?
Ritter: Ich beurteile das gleich. Die Flüchtlingsbewegungen in Europa geben nationalistischen Tendenzen Aufwind. Also aus meiner Sicht ist die Lage verfahren. Gerade vor dem Hintergrund dieser Probleme, welche die EU zurzeit zu wälzen hat. Ich würde sogar sagen: Die Schweiz wäre eher in der Lage, ein Abkommen mit den USA auszuhandeln, als die EU.
Diese Aussage überrascht. Bezüglich eines Freihandelsabkommens USA – Schweiz ist doch gerade die Landwirtschaft ein Knackpunkt?
Ritter: Es ist ganz klar, dass bei jedem Abkommen auch die Interessen der Schweizer Landwirtschaft berücksichtigt werden müssen. Unsere Erwartungen haben wir diesbezüglich dem Bundesrat in einem Brief bereits in Oktober 2013 kundgetan.
Wasescha: Die Frage ist: Wie weit ist die schweizerische Landwirtschaft bereit zu gehen? Das bereitet mir heute Sorgen. Wir haben mit dem Abschluss der Uruguay-Runde 1994 zwar eine Reform der Landwirtschaftspolitik eingeläutet. Eine schrittweise Öffnung der Agrarmärkte sowie eine Senkung der Agrarsubventionen wurden vereinbart. Seit einigen Jahren geht hier jedoch nichts mehr. Im Gegenteil, wir bewegen uns wieder in die andere Richtung.
Im Moment geht die politische Grosswetterlage in der Schweiz eher wieder in Richtung Unterstützung der Landwirtschaft.
Ritter: Das ist so. Mit den letzten Wahlen sind jene Kräfte im Parlament gestärkt worden, vor allem im Nationalrat, die keine weitere Marktöffnung in der Landwirtschaft wollen. Das trifft in erster Linie auf die SVP zu. Auch die Grünen, die CVP und die BDP sind zurückhaltend. Der politische Spielraum für Freihandelsabkommen, die die Schweizer Landwirtschaft auf dem Altar grenzenlosen Freihandels opfern wollen, ist gering.
Wasescha: Wir kommen jetzt natürlich in eine Situation, in der Freihandelsabkommen nur noch möglich sind mit Partnern, bei denen der Landwirtschaftsteil gewichtiger wird. Für mich war das ein Aha-Erlebnis, als ich offensiv in den Agrarverhandlungen mit Japan war: Die Japaner wollten praktisch nichts geben, und deshalb hatten sie auch keine Forderungen, die relevant waren. Zollfreiheit auf Sake und Bonsaibäumchen tut sogar dem jammerfestesten Landwirt nicht weh. Aber durch die Verhandlungen mit Malaysia und Indonesien und einigen südamerikanischen Ländern wie Brasilien und Argentinien über ein Freihandelsabkommen wird es zu einem erhöhten Öffnungsdruck kommen. Das führt dann zu einer Auseinandersetzung.
Ritter: Die Kunst, den Wirtschaftsstandort Schweiz gut zu positionieren, liegt auch künftig darin, Abkommen zu schliessen, in denen sich breite Wirtschaftskreise wiederfinden. Ein Freihandelsabkommen mit Indien wird beispielsweise durch die Pharmaindustrie verhindert, aufgrund der ungenügenden Bereitschaft Indiens, das geistige Eigentum zu sichern, und nicht durch uns. Wir können mit diesem Abkommen leben. Auch die Verhandlungen mit Malaysia und Indonesien dürften scheitern, wenn ökologischen Anliegen nicht ein völlig anderes Gewicht beigemessen wird: Die Diskussion um das Palmöl laufen den Erwartungen der NGOs im Bereich des Regenwaldschutzes diametral zuwider.
Der Agrarsektor trägt mit weniger als einem Prozent zum Schweizer Bruttoinlandprodukt bei. Was macht die Landwirtschaft in der Schweiz zum Sonderfall?
Ritter: Das ist sicherlich der Verfassungsauftrag von 1996. Die Bevölkerung hat der Landwirtschaft einen multifunktionalen Auftrag – basierend auf der Nachhaltigkeit – erteilt. Daran sind Erwartungen geknüpft. Auch der Grenzschutz ist Teil dieser Erwartungen. Vor zehn Jahren hatte ich noch Angst. Damals hatten uns alle eingeredet, dass eine weitere Öffnung kommen wird. Heute weiss ich: Sie kommt nicht, wenn wir es nicht wollen. Und sie kommt nicht, wenn es keine ausgewogenen Lösungen gibt, hinter denen eine Mehrheit stehen kann. Auch in der Schweiz ist es so: Am Schluss braucht es die Zustimmung in beiden Parlamentskammern – alles andere ist Angstmacherei. Zur euphorischen Öffnungsallianz gehören nach meiner Einschätzung noch die Grünliberalen und Teile der FDP und der SP. Dies dürfte keine Mehrheit mehr sein.
Wasescha: Teil der Erwartungen war nicht der Grenzschutz, sondern gerade umgekehrt ein schrittweiser und flankierter Marktöffnungsprozess. Früher oder später wird dieser Grenzschutz denn auch Schritt für Schritt abgebaut. Ich wünsche mir, dass die Landwirtschaft sich auf diese Situation vorbereitet. Wir haben zahlreiche Erfahrungen gemacht, bei denen viele redliche Leute – wie Herr Ritter – immer wieder gesagt haben: «Die Öffnung kommt nicht.» Und dann ist es doch passiert. Ich nenne das Beispiel Bankgeheimnis. Meine Sorge ist es, dass wir uns eben etwas leichtfertig über die internationalen Entwicklungen hinwegsetzen und dann total überrascht tun, wenn etwas passiert. Der Anteil an Bauern geht zurück. Dies führt bereits in einzelnen Regionen zur Gelegenheit zu rationalisieren und zu Betriebszusammenschlüssen oder zur stärkeren Zusammenarbeit. Aber in anderen Regionen ist man einfach festgenagelt: Diese Bauern werden den höchsten Preis bezahlen müssen, wenn die Öffnung kommt. Denn im Gegensatz zu Herrn Ritter sage ich, dass die Öffnung kommt. Zumindest müsste man einen Plan B haben. Und von dem höre ich nichts.
Ritter: Den suchen wir auch nicht. Denn wir haben negative Erfahrungen gemacht mit dem Käsefreihandel mit der EU. Das hat uns auf dem falschen Fuss erwischt. Nicht weil wir keine guten Produkte hätten, sondern weil der Wechselkurs zum Euro im Jahr 2007 von 1.65 auf 1.10 Franken gefallen ist und unter anderem dadurch die Milchpreise im Keller sind. Davon hat damals niemand geredet. Und von den grossen Propheten, die uns in der Milchwirtschaft in den Jahren 2000 bis 2009 die Marktordnung verkauft haben, höre ich niemanden mehr. Es ist nicht möglich in der Schweiz, mit Nahrungsmitteln bei der aktuellen Frankenstärke ohne Grenzschutz erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben. Die Kosten sind dafür zu hoch.
Der Käsefreihandel mit der EU ist doch eine Erfolgsgeschichte?
Ritter: Die damaligen Überlegungen, die einen Käsefreihandel mit der EU lukrativ haben erscheinen lassen, sind heute überholt. Mit einer Verkäsungszulage von 15 Rappen und dem damaligen Wechselkurs wäre dies auch jetzt noch ohne Weiteres möglich. Jeder weiss nun aber, dass der Eurowechselkurs nicht mehr bei 1.65 oder 1.40 Franken liegt, sondern nur noch bei 1.10 Franken. Dies hat einen gewaltigen Druck auf unsere Wertschöpfung ausgelöst. Dieser Wertschöpfungsverlust bei den Milchprodukten wird zu einem grossen Teil von den Milchbauern getragen. Bezüglich Arbeitsverdienst je Stunde liegt die Milchwirtschaft heute am Schluss aller Produktionsrichtungen, also hinter Gemüse-, Obst- und Getreidebau. Das ist keine Erfolgsgeschichte.
Herr Wasescha, warum braucht die Schweiz die Freihandelsabkommen?
Wasescha: Das Ziel der Aussenwirtschaftspolitik ist es, für Exporteure von Gütern und Dienstleistungen sowie für Inhaber von Rechten am geistigen Eigentum den Zutritt und gleich lange Spiesse auf den wichtigsten Märkten zu erhalten. Dies geschieht primär im multilateralen Rahmen der WTO. Im bilateralen oder im plurilateralen Bereich – etwa im Verbund mit den Efta-Ländern Norwegen, Island und Liechtenstein – erlauben es Freihandelsabkommen, schneller und vertiefter diese Ziele anzustreben. Dies ist umso bedeutungsvoller, als wichtige Konkurrenten der Schweiz ebenfalls zum Mittel der Freihandelsabkommen greifen. Stünde die Schweiz abseits, würden sich die Bedingungen für die Wirtschaftsakteure verschlechtern. Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten müssten sie weiterhin Zölle bezahlen. Andererseits verschafft ihnen ein Freihandelsabkommen, wie mit Japan, einen Vorsprung auf ihre EU-Konkurrenten, die immer noch mit Japan verhandeln.
Und die Landwirtschaft?
Wasescha: Ich sage immer: Natürlich ist die Landwirtschaft bei uns teuer, aber schaut, wie schön sie ist: Es ist eine herrliche Landschaft, die ich aus dem Zug zwischen Genf und Bern sehen kann. Und die hat ihren Preis, da bin ich einverstanden. Aber man muss bei den Instrumenten schauen, was man ändern kann. Jetzt müssen wir in den nächsten fünf Jahren das Schoggi-Gesetz, also die Exportsubventionen für Getreide- und Milchprodukte, aufheben. Für einmal sind es nicht die Bauern, die da betroffen sind, sondern die Verarbeiter. Der Lärm ist riesig, obwohl die WTO die Abschaffung der Exportsubventionen schon 2005 beschlossen hatte. Niemand hat geglaubt, dass es kommt. Das scheint mir eine gefährliche Situation zu sein.
Ritter: Der Bundesrat hatte bereits das Verhandlungsmandat so formuliert, dass klar war: Er will diese Exportförderung mit dem Schoggi-Gesetz aufgeben. Meine Enttäuschung ist einfach, dass schlussendlich die Schweiz fast das einzige Land ist, in welchem eines dieser möglichen Instrumente im Rahmen des Parallelismus-Grundsatzes korrigiert worden ist. Bei den Amerikanern sind die Lebensmittelhilfen immer noch erlaubt.
Wasescha: Wäre das Resultat etwa besser geworden, wenn wir aggressiv gegen die amerikanische Praxis vorgegangen wären und gesagt hätten: Wir machen das nur, wenn das auch die Amerikaner machen?
Ritter: Wenn ich in eine solche Verhandlung gehen würde, hätte ich nicht bereits sämtliche Trümpfe, die ich habe, am Anfang zur Disposition gestellt und nur noch um die Termine gerungen. Aber das war die Entscheidung des Bundesrates. Wenn ich eine Kuh für 3000 Franken verkaufen will, gehe ich nicht von Anfang an mit der Vorstellung von 3000 Franken in die Verhandlung, sondern versuche noch etwas höher einzusteigen. Aber das ist vielleicht eine bäuerliche Einstellung.
Wasescha: Der Grundsatzentscheid der WTO zum Ende der Ausfuhrbeiträge ist bereits 2005 in Hongkong gefällt worden. Mir kommen die Lausbubentricks in den Sinn, die wir bei den damaligen Verhandlungen erlebt haben, als Importeure und Produzenten gesagt haben: «Für eine gesunde Landwirtschaft brauchen wir einen Zollschutz von 5000 Prozent auf der Petersilie.» Da muss ich sagen: Nun hört mal auf! Die Schweiz gilt als vorbildlich im Einhalten internationaler Verpflichtungen. Aber wenn ich denke, was wir in der Landwirtschaft gemogelt und mit gut formulierten Fussnoten erreicht haben, dann ist das einer italienischen Oper würdig.
Was sagen Sie zu diesen sogenannten Lausbubentricks, Herr Ritter?
Ritter: Ich kann dieses Wording nicht ganz nachvollziehen. Es war doch der Bundesrat, der diese Anträge eingereicht hat. Die Staatengemeinschaft war einverstanden. Heute sind diese Zölle bei der WTO so notifiziert. Ich gehe davon aus, dass auf dieser Ebene alle Verantwortlichen sorgfältige Arbeit geleistet haben.
Wasescha: Es stimmt, dass alle diese Vorschläge eingereicht wurden, aber niemand hatte Zeit, sie zu überprüfen. Die Zeit war knapp, und man hat nur die grössten Teilnehmer am Agrarmarkt untersucht. Und vieles ist da einfach durchgegangen.
Was wäre, wenn man die Schweizer Landwirtschaft dem Freihandel aussetzen würde?
Ritter: Wenn sich die Bauern beim heutigen Stand der Direktzahlungen ökonomisch richtig verhalten, dann müssten sie stark extensivieren und versuchen, die Kosten und die Arbeitsbelastung auf den Höfen zu minimieren. Entsprechend würden sie kaum mehr Lebensmittel produzieren und versuchen, mittels Nebenerwerb zusätzliche Einkommen zu generieren.
Wasescha: Die ersten Opfer wären nicht spezialisierte Klein- und Mittelbetriebe im Mittelland. Die Situation der Berglandwirtschaft hingegen ist im Prinzip mit den Direktzahlungen sehr gut.
Ritter: Der Erste, der aufhören müsste, wäre der Gemüseproduzent mit seinen Fremdarbeitskräften. Die Löhne sind durch die flankierenden Massnahmen geschützt und im internationalen Vergleich zu hoch. Dieser Gemüsebauer wäre nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber Anbietern aus Baden-Württemberg, Bayern, Spanien oder Italien. Der Zweite, der weg wäre, ist der Obstproduzent. Auch er braucht Fremdarbeitskräfte. Und der Dritte, der ebenfalls unter Druck käme, wäre der Weinbauer. Dann würde sicher die Fleischproduktion recht deutlich eingeschränkt, weil auch dort der Grenzschutz sehr wichtig ist.
Wasescha: Und die Getreideproduzenten?
Ritter: Die Kosten sind dort eher tiefer, aber man verdient heute schon fast nichts mehr in diesem Bereich. Viele würden auch den Getreidebau einstellen.
Wasescha: Das Horrorszenario von Herrn Ritter würde sicher eintreffen, wenn das in relativ kurzer Frist passieren würde. Wenn wir das aber schrittweise machen, dann passen sich die Bauern an.
Mit Kompensationszahlungen und langen Übergangsfristen?
Wasescha: Nein, mit Spezialisierung. In Genf gibt es beispielsweise eine Gemüsespezialität, die «Cardon Genevois». Das ist eine Distelart. Sie wird traditionell an Weihnachten gegessen. Die Nachfrage ist so gross, dass die Produktion kaum mithalten kann. Das hat seinen Preis: Ein Kilo im Glas kostet 16 Franken. Im Direktverkauf in Stadtnähe sehe ich für viele eine Zukunft. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, solange die Bevölkerung die Kaufkraft hat.
Zitiervorschlag: Nicole Tesar (2016). Braucht die Schweiz die Agrarmarktöffnung. Die Volkswirtschaft, 25. Mai.
Luzius Wasescha
Alt Botschafter Luzius Wasescha (69) ist seit 2013 Präsident der Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz (Igas). Die Organisation setzt sich für einen schrittweisen und flankierten Öffnungsprozess des Agrarsektors ein. Der ehemalige Schweizer Chefunterhändler bei der WTO war Leiter des Leistungsbereichs Welthandel im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Wasescha ist Lehrbeauftragter für Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität St. Gallen. Er lebt zusammen mit seiner Frau in Genf.
Markus Ritter
Der St. Galler CVP-Nationalrat Markus Ritter (48) ist seit 2012 Präsident des Schweizer Bauernverbands. In Altstätten führt er zusammen mit seiner Frau einen Bio-Landwirtschaftsbetrieb. Der Grossteil des Betriebes befindet sich in der Bergzone. Auf dem Hof hat es Milchkühe, Jungvieh zur Aufzucht, Mutterschafe und Bienenvölker. Das Paar hat drei Kinder.
Das könnte Sie auch interessieren