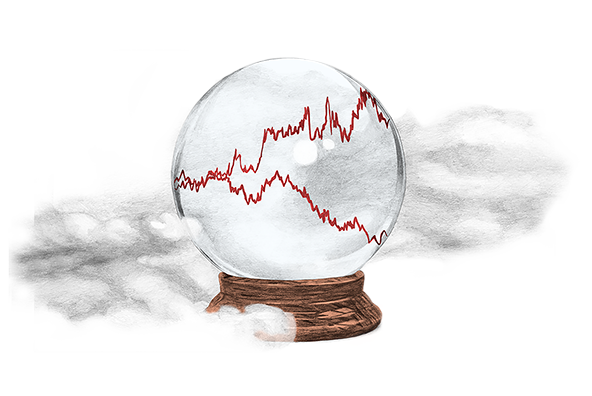Den Klassikern ging es um die lange Sicht: Was sind die Antriebe der Menschen, was die Quellen von Wohlstand und Wachstum? (Bild: Corbis)
Die Finanzwirtschaft hat in der Ökonomie an Gewicht gewonnen. Das zeigt sich zum Beispiel an den Löhnen und Profiten, die im Finanzsektor entstehen, an der Absorption qualifizierter Arbeitskräfte, der Zahl der gehandelten Produkte oder am Nominalwert der Transaktionen relativ zum Bruttoinlandprodukt. «Finanzialisiert» hat sich auch das ökonomische Denken, insbesondere die Sicht auf wirtschaftliche Störungen: Liquidität und Erwartungsmanagement stehen im Zentrum der Ursachensuche, geldpolitische Instrumente erscheinen als die Lösung.
Dieser Fokus auf die Finanzmärkte wird der Volkswirtschaftslehre nicht gerecht, wie ein Blick in die Geschichte des ökonomischen Denkens erkennen lässt. Die folgende Betrachtung konzentriert sich auf Themen, welche die Entwicklung der modernen Volkswirtschafslehre massgeblich bestimmt haben.
Der Markt und sein Versagen: Selbststeuerung oder Intervention
Der Begründer der klassischen Nationalökonomie, Adam Smith (1723–1790), hat die Idee ausgearbeitet, dass Individuen bei freier Entfaltung ihrer Kräfte und Antriebe auf Märkten ohne zentrale Steuerung zu einem guten Ganzen finden. Sie sind dabei motiviert durch Eigenliebe, aber auch zu Empathie fähig und mit einem gewissen Pflichtgefühl ausgestattet. In der Folge hat David Ricardo (1772–1823) die Idee auf das Zusammenspiel von Ländern ausgeweitet und ist so ein Pionier des freien internationalen Handels geworden. Über Léon Walras (1834–1910) wurde dieser Entwicklungsstrom fortgeführt und in der rigorosen Formulierung der allgemeinen Gleichgewichtstheorie durch Kenneth Arrow (*1921) und Gerard Débreu (1921–2004) zu einem vorläufigen Abschluss gebracht.
Das zentrale Ergebnis daraus sind die Hauptsätze der Wohlfahrtsökonomie. Sie können als Antwort auf den Streit zwischen Markt- und Planwirtschaft gesehen werden, der als Mises-Lange-Kontroverse in die Geschichte eingegangen ist – benannt nach den Kontrahenten Ludwig von Mises (1881–1973) auf der Marktseite und Oskar Lange (1904–1965) auf der Planseite. Grob gesprochen besagen diese Lehrsätze: In einer «erstbesten» Welt sind die Systeme austauschbar, beide führen zu einem effizienten Ergebnis. Erstbeste Welt heisst, dass man eine wohlwollende und perfekt informierte Planbehörde mit vollständigen Märkten und freiem Wettbewerb vergleicht, in denen es keine Marktmacht oder Informationsprobleme gibt. Die reale Welt sieht selbstverständlich anders aus. Das Ringen um den richtigen Blick auf das Wirtschaftssystem findet somit auf dem Feld der Unvollkommenheiten statt.
Beschränktes Wissen: Informationsverarbeitung durch Marktpreise
Eine grundlegende Unzulänglichkeit der menschlichen Natur ist das beschränkte Wissen. Der österreichische Ökonom Friedrich von Hayek (1899–1992) hat dargelegt, dass die Preisbildung am Markt als dezentraler Mechanismus der Informationsverarbeitung verstanden werden kann. Da das Wissen über Wünsche und Fähigkeiten bei den Individuen liegt, ist es effizient, sie mit diesem Wissen auf die Marktgegebenheiten reagieren zu lassen, die in den Preisen zum Ausdruck kommen. Wenn die individuellen Reaktionen im Aggregat zu Widersprüchen führen, werden sich die Preise anpassen, bis das verstreute Wissen korrekt eingesammelt und der Markt im Gleichgewicht ist.
In Fortführung der Hayek’schen Idee von Märkten als dezentralem Mechanismus der Informationsverarbeitung hat die moderne Finanztheorie das Konzept informationseffizienter Finanzmärkte entwickelt. Freie Arbitrage führt demnach zu einer Koordination der Meinungen im Einklang mit dem insgesamt vorhandenen Wissen. Doch auch der Preismechanismus kann gestört sein. Die Debatte, ob diese Störungen durch Intervention behoben werden sollen oder Interventionen gerade die Selbstheilung durch den Markt verhindern, gewinnt neue Brisanz. Marktungleichgewichte sind einerseits Auslöser für Preisanpassungen und ein wichtiger Input für die Informationsgewinnung. Andererseits sind sie Ausdruck dafür, dass etwas schiefläuft: Es gibt übervolle Lager oder Warteschlangen, Arbeitslosigkeit oder Inflation, Finanzmarktblasen und Finanzkrisen.
Theorie der effektiven Nachfrage
Der britische Ökonom John Maynard Keynes (1883–1946) hat sehr früh die problematische Rolle des Marktes aufgezeigt, welche dieser für die Koordination von Wissen und Meinungen spielt. So werden Geschäfte auf Grundlage von Konventionen und einer allgemeinen Erwartungshaltung bezüglich der Zukunft getätigt. Das führt zu Herdeneffekten, die durch stabilisierende Fiskal- und Geldpolitik im Zaum gehalten werden sollen. Falls die Erwartungen pessimistisch sind, halten die Wirtschaftsakteure grosse Summen liquider Mittel, statt in reale Projekte zu investieren. In so einer Situation ist die Geldpolitik machtlos und Ankurbelung durch staatliche Investitionen gefragt.
Keynes hat damit, zusammen mit seinem polnischen Zeitgenossen Michal Kalecki (1899–1970), die Theorie der effektiven Nachfrage begründet, die dem Say’schen Gesetz für die kurze Frist seine Gültigkeit abspricht. Das Gesetz, benannt nach Jean-Baptiste Say (1767–1832), besagt: Jedes Angebot schafft seine Nachfrage. So bestimmen insbesondere die Ersparnisse die Investitionen. Denn niemand würde auf etwas verzichten, wenn dahinter nicht der Wunsch stünde, etwas nachzufragen. Demgegenüber betont die Theorie der effektiven Nachfrage, dass nicht der Wunsch, sondern die Kaufkraft über die tatsächliche Nachfrage entscheidet, und der Wunsch zu sparen erst durch reale Investitionen realisiert werden kann.
Die auf den rationalen Erwartungsmodellen basierende moderne Makroökonomie hat den geldpolitischen Teil der keynesianischen Stabilisierungspolitik akribisch verarbeitet und mit Erfolg zu einem wirksamen Mittel der Moderation von Schwankungen in normalen Zeiten ausgebaut. In ausgeprägten Krisenzeiten bestätigt sich jedoch: Geldpolitik allein hat einen zweifelhaften Nutzen. In einer Liquiditätsfalle bläht das zusätzlich in Umlauf gebrachte Geld eher die Spekulationskasse auf, als dass damit reale Investitionsprojekte der Firmen angestossen werden.
Für die Entwicklung des makroökonomischen Denkens im 20. Jahrhundert waren zyklische Ungleichgewichte zentral. Für das Verständnis grundlegenderer Strukturbrüche, wie sie in den letzten Jahren sichtbar geworden sind, lohnt es sich deshalb, zu den Grundfragen der klassischen Politischen Ökonomie zurückzukehren.
Was ist Wohlstand, und wie wird er geschaffen?
Die Ursprünge der modernen Volkswirtschaftslehre sind geprägt von den Fragen: Was ist Wohlstand, wer schafft ihn, wozu dient er, und wie wird er verteilt? Aus merkantilistischer Sicht misst sich Wohlstand am Vermögen, insbesondere am Besitz von Gold, Edelmetallen und anderen Werten. Diese dienen der Finanzierung eines feudalen Lebensstils und der Macht des Landes. Denn der Erwerb von Vermögen ist ein Nullsummenspiel. Was die eine Nation gewinnt, verliert die andere.
Die Physiokraten[1] haben dieser Bestandsbetrachtung den Kreislauf der Produktion gegenübergestellt und betont, dass nur Produktion, in ihrem Fall die landwirtschaftliche Produktion, neuen Wohlstand schafft. Die klassischen Ökonomen Smith, Ricardo und Karl Marx (1818–1883) haben neben Grund und Boden die Arbeit und das Kapital (die in Form von Investitionsgütern akkumulierte vergangene Arbeit) als zentrale Produktionsfaktoren identifiziert. Damit wurden die Schaffung von Wohlstand und seine Verteilung in einen systematischen Zusammenhang gebracht.
Es ist das Verdienst von Smith, die gewaltige Energie von Arbeit und Kapital, angetrieben vom Wunsch nach Aufstieg und Besserung der Lebensverhältnisse, als Quelle des «Wohlstands der Nationen» erkannt und systematisch dargestellt zu haben. Auch die Verteilung des Wohlstands hat er klar angesprochen: «Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der der weitaus grösste Teil ihrer Mitglieder arm und unglücklich ist.»[2]
Dass die Schaffung von Wohlstand – zum Beispiel durch Handelsgewinne – nicht ohne Verteilungskonflikte vor sich geht, war auch Ricardo bewusst. Sein Einsatz für den Freihandel und gegen die Protektion der Landwirtschaft galt als Kampfansage an die Grundbesitzer. In voller Schärfe aber hat erst Marx die Entfesselung der produktiven Kräfte mit der Verteilungsfrage in Verbindung gebracht. Ungerechte, ausbeuterische Verteilung führt in eine Systemkrise. Die Arbeiterbewegung und der moderne Sozialstaat haben dazu beigetragen, diese Systemkrise zu vermeiden. Die Globalisierungswelle in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und die protektionistische Gegenwelle im Vorlauf des Ersten Weltkriegs haben die Wechselbeziehung zwischen der Entfaltung der produktiven Kräfte und den damit verbundenen Verteilungskonflikten stark ins Bewusstsein gehoben. Hundert Jahre später sehen wir erneut, dass unter der Oberfläche der finanzwirtschaftlich orientierten Krisendiskussion die Grundfragen von Wachstum und Verteilung auf die wirtschaftspolitische Agenda drängen.
Die Zeit und ihr Takt
Den Klassikern ging es um die lange Sicht. Was sind die Antriebe der Menschen, was die Quellen von Wohlstand und Wachstum? Wie hängen Produktion und Verteilung zusammen? Das neoklassische Gleichgewicht ist relativ zeitlos. Wann der walrasianische Auktionator arbeitet und wie lange er braucht, um die gleichgewichtigen Marktpreise zu finden, bleibt weitgehend im Dunkel.
Es war vor allem Alfred Marshall (1842–1924), der darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, die Anpassungsprozesse im Auge zu behalten und sorgfältig zwischen «long run», «medium run» und «short run» zu unterscheiden. Keynes hat dann die Bedeutung der kurzen Frist für makroökonomische Ungleichgewichte betont. Ironischerweise hat sich nicht nur die keynesianische Konjunkturtheorie der Idee des kurzfristigen Zyklus verschrieben, sondern auch ihre Kritiker sind im Denkmuster des transienten Schocks gefangen.
Inzwischen, im 21. Jahrhundert, sind dynamische, auf statistischen Prozessen beruhende Gleichgewichtsmodelle zu einem Industriestandard geworden. Man könnte meinen: Endlich wird die Zeit in der Ökonomie ernst genommen. Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein: Es herrscht Frequenzverwirrung; Hochfrequenz und Ewigkeit verbinden sich zu einer undurchsichtigen Allianz. Es ist nicht immer klar, welche spezifischen Prozesse untersucht werden: Sind es Kursschwankungen, Konjunkturzyklen, Finanzzyklen, Wachstums- und Entwicklungsprozesse, Bubbles oder Strukturbrüche? Dasselbe gilt für den jeweiligen Takt: Sind Mikrosekunden, Tage, Quartale, Jahre, Dekaden, Generationen, Jahrhunderte oder Äonen die relevante Frequenz?
Strukturbrüche sind für Analyse zentraler als die Finanzkrise
Im Lichte der Geschichte des ökonomischen Denkens ist die Betrachtung der Welt mit der Brille des Finanzmarkts und der Geldpolitik einseitig, ebenso die Fixierung auf Zyklen oder temporäre Schocks. Besonders fragwürdig erscheint die Tendenz, aktuelle Störungen allein der Finanzkrise im Jahr 2007 zuzuschreiben. Immerhin sind seitdem bald zehn Jahre vergangen, und schon 1997 oder in den Jahren 2000 und 2001 wurde die Welt durch Finanzkrisen geschockt.
Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre regt an, die Störungen in einem grösseren Kontext zu sehen und in eine längerfristige Entwicklung einzuordnen. Dadurch werden grundlegendere Strukturveränderungen sichtbar, ohne deren Verständnis keine nachhaltige Krisenbewältigung gelingen wird. Konzentrieren wir uns dazu auf westliche Industrieländer und auf die Zeit nach dem letzten grossen Einschnitt, der sogenannten Erdölkrise in den Siebzigerjahren, die ja auch mit einem Paradigmenwechsel in Wissenschaft und Politik verbunden ist, markiert durch das Schlagwort «supply-side economics». Was also sind grundlegende Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte?
Zum einen hat sich der Wachstumspfad im Vergleich zu den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg verlangsamt. Parallel dazu ist die Inflation moderat geworden oder gar verschwunden. Zum andern sind durch Deregulierung und Privatisierung – einschliesslich der Transformation von Planwirtschaften in Richtung Marktsystem – grosse Bestände von Ressourcen und Realkapital auf den Markt gekommen. Das hat den Erwerb und Handel mit Eigentumsrechten attraktiv gemacht, den Finanzmarkt stimuliert und einer merkantilistischen Vorstellung von Reichtum Auftrieb verschafft.
Darüber hinaus hat in den letzten 40 Jahren eine starke Globalisierung stattgefunden, die nicht nur die Gütermärkte, sondern auch die Faktormärkte und den Geldmarkt erfasste. Wanderungen von Personen sind nicht gleich Güterströmen und der freie internationale Handel mit Eigentumsrechten greift direkt in den souveränen Gestaltungsspielraum eines Landes ein. Gleichzeitig haben sich grosse Leistungsbilanzungleichgewichte aufgebaut. Der dem wirtschaftspolitischen Ziel des aussenwirtschaftlichen Gleichgewichts entsprechende Wechsel von Defizit- und Überschussperioden wurde abgelöst durch ein anhaltendes Muster von Schuldner- und Gläubigerländern.
Auch die Verteilung der Einkommen hat sich substanziell geändert. Die Ungleichheit am oberen Ende der Verteilung ist stark angestiegen, und in wichtigen Industrieländern sind die Medianlöhne gesunken, zuletzt auch die Lohnquoten. Das alles wurde überlagert vom disproportionalen Wachstum der Finanztransaktionen im Vergleich zur realen Dynamik. Schliesslich haben Bankenkrisen und die Rettung von Banken mit staatlichen Mitteln vor Augen geführt, dass die Selbstheilungskräfte des Marktes gerade im vermeintlich effizienten Finanzmarkt nicht wirken.
Deshalb braucht es eine Rückkehr zum realen Blick auf die Welt. Der Wunsch, reich zu werden in Form von Geld oder Optionen auf zukünftige Werte, schafft keinen «Wohlstand von Nationen». Zukunft wird durch reale Wünsche und reale Anstrengungen geschaffen. Die entscheidenden Fragen lauten: Was sind die grossen Bedürfnisse und Wünsche der Zukunft, die wir oder unsere Kinder durch Investitionen und Wachstum befriedigen wollen? Welche Finanzdienstleistungen brauchen wir, um Ressourcen und Investitionsgüter den gewünschten künftigen Verwendungen zuzuführen? Wie gelingt es, alle an den Früchten des Wachstums teilhaben zu lassen, damit sie motiviert sind, ihre Leistung einzubringen?
- Vorläufer der klassischen Ökonomen; Physiokratie (Herrschaft der Natur). []
- «No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.» An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776], zitiert nach der von Edwin Cannan herausgegebenen Methuen University Paperbacks Fassung, S. 88. []
Zitiervorschlag: Josef Falkinger (2015). Finanzen überschatten das ökonomische Denken. Die Volkswirtschaft, 23. Juli.
Das könnte Sie auch interessieren

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO