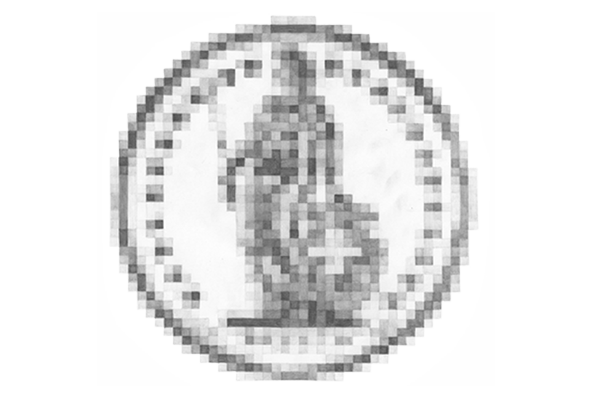Während seiner Studienzeit gründete Luzius Meisser mit dem Speicherdienstleister Wuala selbst ein Start-up. (Bild: Marlen von Weissenfluh, Die Volkswirtschaft)
Herr Meisser, Sie haben den Speicherdienstleister Wuala zusammen mit Dominik Grolimund an der ETH Zürich entwickelt. Existieren an Schweizerischen Hochschulen Strukturen, die gute Ideen erkennen und eine Firmengründung fördern?
Ja, wir haben damals sämtliche Venture-Lab-Module des Instituts für Jungunternehmen besucht. Die Saat war aber schon vorher da. Wir hatten von Beginn weg die Absicht, eine eigene Firma zu gründen. Von grossem Nutzen bei diesen Angeboten ist der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich habe dabei sogar mehr gelernt als bei den eigentlichen Kursinhalten.
Was genau ist das Wertvolle beim Austausch?
Aufschlussreich war, zu sehen, wie sich die anderen Firmen präsentieren, was sie für Ideen haben und wie sie aufgestellt sind. Das gibt ein Gefühl dafür, sich relativ zueinander zu beurteilen und besser abschätzen zu können, ob die eigene Idee überhaupt etwas taugt.
Gilt das Gleiche für die sogenannten Hubs?
Genau. Der Plattformcharakter ist wichtig. Hubs sind Treffpunkte, wo Gründer arbeiten und sich beispielsweise über Technologien austauschen können. Ein Beispiel ist das Colab in Zürich. Es gibt dort einen offenen Workspace für digitale Nomaden, wo man einen Kaffee trinken und seinen Laptop anschliessen kann. Im Kommen sind auch Dienste wie Popup Office, mit denen man ad hoc geeignete Arbeitsplätze und bei Bedarf auch Meeting-Räume finden und buchen kann.
Stehen aus Ihrer Sicht in der Informations- und Kommunikationstechnologie genügend Förderprogramme zur Verfügung?
Ja! Es sind schon fast zu viele, denn wer an vielen Wettbewerben teilnimmt, muss jedes Mal einige Stunden für das Dossier und die Präsentation aufwenden. Meistens gewinnt man dann doch nicht. Am Ende verbrät man für solche Wettbewerbe sehr viel Zeit, die man besser in das Produkt selbst investiert hätte.
Die Wettbewerbe werden von privater Seite finanziert.
Ja, da sind oft Stiftungen engagiert. Es gibt schon fast ein Überangebot an Start-up-Events. Es ist ein Modethema geworden, und man muss als Start-up selektiv vorgehen.
Was sind die Erwartungen von Start-up-Gründern an den Staat?
Der Staat soll möglichst nicht im Weg stehen. Er ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Es muss einfach sein, eine Firma zu gründen und Leute einzustellen. Dafür ist es auch wichtig, auf Augenhöhe mit den Behörden reden zu können, was in der Schweiz dank dem ausgeprägten Föderalismus gut funktioniert. Wenn man zum Beispiel jemanden aus der EU anstellen möchte, kann man problemlos das lokale Arbeitsamt anrufen und erhält eine kompetente Auskunft.
Ist es in der Schweiz einfach, eine Firma zu gründen?
Leider ist es nicht mehr so einfach wie auch schon. In letzter Zeit höre ich vereinzelt von Start-ups, die Mühe haben, eine Bank für das Gründungskonto zu finden – zum Beispiel weil US-Investoren mit dabei sind. Das Gesetz schreibt aber vor, dass man ohne Gründungskonto bei einer Schweizer Bank auch keine Firma gründen darf. Ein Freund von mir führt ein korrekt Finma-reguliertes Start-up, das mit Bitcoins handelt. Es ist ihm aber nicht gelungen, in der Schweiz ein Bankkonto zu eröffnen, obwohl er bei über 50 Banken die entsprechenden Formulare ausgefüllt hat. Nun ist er bei einer Bank in Liechtenstein. Das ist problematisch, denn der Finanzplatz Schweiz ist langfristig auf Start-ups und Innovation angewiesen.
Aber grundsätzlich gibt es keine grossen Hürden, eine Firma zu gründen?
Ja, da trifft zu. Es sind nämlich eine zunehmende Anzahl kleiner Hürden, die bremsen.
In der Schweiz vergibt der Staat keine direkten Förderbeiträge. Ist das aus Ihrer Sicht ein Nachteil?
Über die KTI (Kommission für Technologie und Innovation, Anm. d. Red.) und den Schweizerischen Nationalfonds sind Innovationsprojekte finanzierbar. Ich halte es für korrekt, dass der Staat nicht direkt fördert.
Warum?
Nehmen wir als Beispiel Myke Näf, einen der Gründer von Doodle. Wie alle anderen erfolgreichen Gründer, die ich kenne, investiert er das damit verdiente Geld nun in neue Start-ups, an die er persönlich glaubt. Wenn das schiefgeht, verliert er sein eigenes Geld. Er hat also alles Interesse daran, sich das Start-up genau anzusehen. Direkte Förderbeiträge würden nun darauf hinauslaufen, dass der Staat Myke dieses Geld wegnimmt, bis es über sieben Umwege in einem Fördertopf landet, über dessen Verwendung ein Beamter ohne «skin in the game» entscheidet. Das ist offensichtlich Unsinn, denn dabei geht nicht nur Geld unterwegs verloren, sondern es wird auch Smart Money zu Dumb Money gemacht.
Was ist Smart Money beziehungsweise Dumb Money?
Es gibt verschiedene Arten von Investoren. Auf der einen Seite gibt es Investoren, die Geld haben, aber wenig Ahnung vom konkreten Geschäft – zum Beispiel Pensionskassen. Sie können dementsprechend auch kaum über die Finanzierung hinaus zum Erfolg beitragen. Das ist sogenanntes Dumb Money. Smart Money kommt von Investoren, die auch ein Netzwerk, viel Erfahrung mitbringen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für Start-ups ist es essenziell, dass sie Smart Money erhalten. Das macht einen enormen Unterschied.
Die Schweiz bekommt gute Noten, wenn es um die Frühförderung von Start-ups geht. Vernachlässigt die Schweiz die darauffolgende Phase, etwa bei der Finanzierung von Beiträgen von über anderthalb Millionen?
Ja, das ist ein bisschen schwieriger in der Schweiz, aber ich denke, es ist immer noch einfacher als im restlichen Europa. Denn in der Schweiz ist Geld vorhanden, und es gibt auch Leute, die eine grössere Finanzierungsrunde schultern können. Was es in der Schweiz nicht gibt, sind exzessive Bewertungen wie etwa bei Uber, das angeblich gleich viel wert sein soll wie die gesamte Credit Suisse.
So etwas wäre also in der Schweiz nicht möglich?
Das liegt an der Selbstverstärkung von Smart Money. In den USA ist dieser Prozess schon älter. Jeder Zyklus mit erfolgreichen Start-ups wirft wiederum mehr Geld mit mehr erfolgreichen Gründern ab. Das Venture-Capital hat sich dort daher multipliziert. Es steht immer mehr Geld zur Verfügung, während die Anzahl Start-ups begrenzt ist, weil auch die Anzahl Leute begrenzt ist, die dort arbeiten. Von daher werden die Bewertungen mit zunehmendem Erfolg immer abenteuerlicher.
Ist die Finanzierung ein Problem, wenn man auf den globalen Markt zielt? Im Internetbusiness kommt das häufig vor.
Nach meiner Erfahrung können gute Firmen mit einem guten Plan Geld kriegen. Ich denke, das Problem liegt anderswo, nämlich in den geografischen Voraussetzungen. Aus der Schweiz heraus muss man Sprachbarrieren und kulturelle Hürden überwinden, wenn man 300 Millionen Kunden erreichen will. Was in der Schweiz funktioniert, muss noch lange nicht in Deutschland oder Frankreich funktionieren. In den USA hingegen befindet man sich von Anfang an in einem wesentlich grösseren Markt. Das ist auch dann relevant, wenn rechtliche Barrieren bestehen. So musste zum Beispiel der europäische Musikdienst Spotify den Marktzugang in jedem Land neu mit den Verwertungsorganisationen verhandeln. Da sich die Geografie nicht so leicht ändern lässt, sollte die Schweiz vielleicht besser nicht das Silicon Valley imitieren, sondern sich auf die eigenen Stärken besinnen. Und diese sind traditionell eher «klein, aber fein» als «gross und klotzig».
Ein bekannter Start-up-Gründer sagte in der Presse, dass es für Schweizer Start-ups schwierig sei, mit dem Takt der Internetwirtschaft und der Digitalisierung mitzuhalten. Der Puls hierzulande sei etwas tiefer. Mit anderen Worten: Wir ticken etwas langsamer. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich denke, die Schweizer sind weniger risikobereit und weniger erfolgshungrig, als dies etwa in den USA der Fall ist. Der Referenzpunkt ist natürlich das Silicon Valley. Ich denke, dass das in Europa allgemein ein Problem ist. Wenn man in der Schweiz Informatik studiert hat, muss man sich entscheiden, ob man eine gut bezahlte, interessante Stelle annehmen soll – denn jeder Absolvent findet einen Job, und wenn man talentiert ist, kann man sogar auswählen und 8000 Franken monatlich verdienen –, oder soll man das Risiko eingehen, ein Start-up zu gründen, und drei bis vier Jahre ohne nennenswerten Lohn Tag und Nacht arbeiten, ohne zu wissen, was nach dieser Zeit passiert.
Wie gross ist der Anteil der Start-ups, die den Durchbruch schaffen?
Man sagt eines von zehn Start-ups werde erfolgreich. Das ist ein extremes Risiko, und wenn man es eingeht, muss man auf viel verzichten. Diese Anreize sind in den USA etwas günstiger. Dort hat man auch bei den bequemen Jobs kaum Ferien, und wenn man mit dem Start-up «den Sechser zieht», kann man schneller mehr verdienen. Aus diesem Anreiz heraus gibt es in der Schweiz weniger Leute, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Eigentlich ist es ein Luxusproblem. Man könnte auch sagen, dass es uns ein wenig zu gut geht und es deshalb gar nicht nötig ist, dieses Risiko einzugehen.
Das Ergebnis wäre langweiliges Mittelmass.
Das Problem mit Riskoaversion ist, dass ohne Risiko keine Innovation entsteht. Man kann tausend gute Ideen haben, aber wenn niemand hinsteht und das Risiko eingeht, diese umzusetzen, bleiben es Ideen. Und Risiken gibt es viele. Es gibt Marktrisiken, produkttechnische Risiken, aber eben auch rechtliche Risiken. In einer Welt, in der Risiken um jeden Preis unterbunden werden, erstickt man auch die Innovation.
Welche Rolle spielen rechtliche Risiken?
Der Fahrdienstvermittler Uber beispielsweise ist ein arbeitsrechtliches Risiko, da ein Gericht entscheiden könnte, es bestehe ein Arbeitsverhältnis zu den Fahrern, womit das Geschäftsmodell nicht mehr aufgehen würde. Zudem sind Taxidienste oft sehr stark reguliert, was schwer mit dem Modell von Uber vereinbar ist. Ein anderes Beispiel ist Youtube, welches unter schweizerischem Urheberrecht wohl nicht hätte entstehen können, da wir keine «safe harbor»-Klausel haben. In diesem Zusammenhang ist es enorm wichtig, dass wir dafür sorgen, dass Schweizer Start-ups gleich lange Spiesse haben wie alle anderen. Gerade im Finanzbereich wäre das wichtig, wenn wir Fintech-Start-ups anziehen wollen. Das hat unter anderem Mark Branson von der Finma erkannt. Er empfiehlt neuerdings, die Gesetze zu lockern. Ein anderes Beispiel sind Leserkommentare. Während Schweizer Start-ups wie Watson.ch rechtlich gezwungen sind, jeden einzelnen Nutzerkommentar zu moderieren, darf Facebook Nutzerkommentare umgehend und ungesichtet veröffentlichen. Je einfacher und grundsätzlicher Gesetze formuliert sind, desto zukunftstauglicher sind sie. Die Schweiz ist in dieser Hinsicht zum Glück vergleichsweise stark.
Gibt es etwas, was der Staat tun könnte, um die Risikobereitschaft zu fördern?
In der Vergangenheit waren es sehr oft Immigranten, welche die sehr erfolgreichen Firmen gegründet haben. Beispielsweise Sergey Brin, der Mitgründer von Google, dessen Eltern aus Russland stammen, oder Steve Jobs, dessen leiblicher Vater ein Syrer war. Auch in der Schweiz gibt es viele grosse Firmen, die von Einwanderern gegründet wurden, beispielsweise Swatch oder Nestlé. Ich denke, da gibt es schon ein Muster. Jemand, der von aussen kommt, hat einen stärkeren Anreiz, sich zu beweisen. Oft haben Leute, die Entbehrlichkeiten auf sich nehmen und von weit herkommen, um etwas zu erreichen, auch einen sehr langen Atem.
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für die Rolle des Staates?
Man könnte natürlich versuchen, gezielt solche Leute anzuziehen und in die Schweiz zu holen. Man könnte zum Beispiel alljährlich die tausend besten Bewerber aus aller Welt an einer Schweizer Fachhochschule oder Universität studieren lassen. Politisch ist es natürlich immer heikel, wenn es um Migration geht, aber das Bruttoinlandprodukt liesse sich damit höchstwahrscheinlich erhöhen. McKinsey spricht von einem drohenden «Krieg um Talente». Die knappe Ressource sind heute die fähigen Leute. Bezüglich Finanzierung und Infrastruktur sind wir in der Schweiz gut aufgestellt.
Wuala wird am 15. November seinen Dienst einstellen. Was ist schiefgelaufen?
Wuala hat sieben Jahre lang Millionen von Benutzern grossen Nutzen gebracht und war von daher ein Erfolg. Auch von den ursprünglichen Konkurrenten hat inzwischen die Mehrheit den Dienst eingestellt. Wie es bei Wuala konkret zu dieser Entscheidung gekommen ist, weiss ich nicht, da ich seit Anfang 2013 nicht mehr involviert war. Wuala ist aber in einem Geschäftsfeld tätig, das immer mehr an Bedeutung verliert. Das gleiche Problem hat auch Dropbox. Die Leute werden immer weniger oft mit Dateien und Ordnern konfrontiert. Auf dem Handy gibt es zum Beispiel keinen «file explorer» mehr. Erschwerend hinzu kommt, dass inzwischen grosse Internetfirmen wie Google und Microsoft ähnliche Angebote gratis und oft schon vorinstalliert zur Verfügung stellen.
Big Data, Digitalisierung der Wirtschaft, Internet der Dinge – diese Begriffe sind momentan in aller Munde. Jungunternehmen werden von Internetgiganten wie Google teilweise für mehrere Milliarden übernommen. Wird diese Entwicklung nicht überbewertet?
Das muss die Zukunft zeigen. Wir wissen es nicht. Natürlich ist es eine Spekulation auf eine zukünftige Entwicklung, welche eintreffen oder aber auch nicht eintreffen kann.
Konzerne wie die Post und die SBB greifen mittels Investmentfonds oder Förderpreisen Jungunternehmern unter die Arme – ist das ein guter, nachhaltiger Weg?
Es ist vor allem ein Sachzwang, wenn sie einen Fuss in der Tür zur Zukunft haben wollen. Die erstbeste Methode, das zu machen, ist natürlich, indem man von Anfang an bei diesen Start-ups mitmacht und dabei ist. Das ist sinnvoll. Es garantiert zwar keinen Erfolg, aber es ist eine gute Strategie.
Sie machen im Moment den Master in Volkswirtschaftslehre. Was versprechen Sie sich als Start-up-Gründer von diesem Zusatzstudium?
Das ist persönliches Interesse. Ich glaube nicht, dass das in der Start-up-Welt hilft. Volkswirtschaft ist für mich ein extrem spannendes Thema, weil es schlussendlich darum geht, wie die Welt funktioniert. Inspiriert dazu hat mich Hari Seldon aus Isaac Asimovs «Foundation»-Trilogie. Ich war in der komfortablen Situation, dass ich mich zwei Jahre aus reinem Interesse mit etwas beschäftigen durfte, unabhängig davon, ob sich das als nützlich erweisen wird.
Zitiervorschlag: Nicole Tesar (2015). «Der Staat sollte möglichst nicht im Weg stehen». Die Volkswirtschaft, 26. Oktober.
Luzius Meisser (35) ist in Klosters aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Informatik studiert. 2007 gründete er zusammen mit Dominik Grolimund den Speicherdienstleister Wuala. 2009 verkauften die Jungunternehmer ihre Firma an die französische LaCie, welche wiederum 2012 von Seagate übernommen wurde. Darauf verliess Meisser Wuala, engagierte sich als Seed-Investor bei mehreren Start-ups und unterrichtete an der FHNW Brugg Informatik. Seit zwei Jahren studiert er Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Er schliesst das Studium voraussichtlich im November ab. Der Titel seiner Masterarbeit lautet «Mastering Agent-Based Economics». Nebenbei ist Meisser Präsident der Bitcoin Association Switzerland. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Zürich.