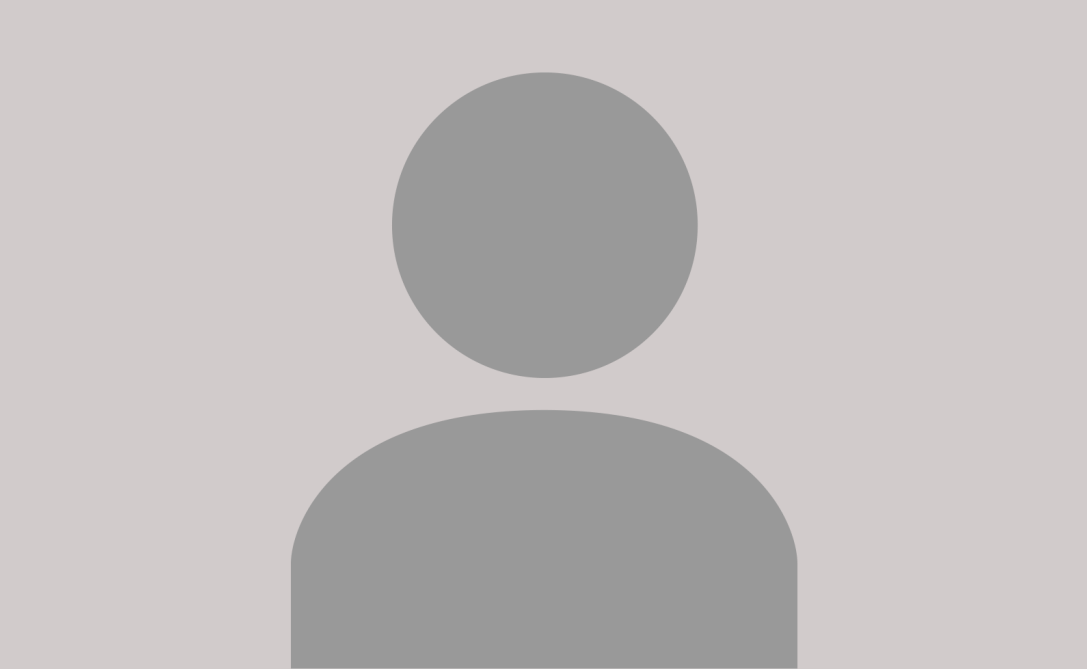Nachhaltige Textilien: Hoffnungsträger und Knackpunkte

Zusammengepresste Kleider im Sortierbetrieb: Rund 60 Prozent der gesammelten Kleider können wieder getragen werden. (Bild: Keystone)
Ob T-Shirt, Vorhang oder Spitalkittel – Textilien sind ein fester Bestandteil unseres Alltags. Doch ihre Herstellung und Entsorgung hat eine Kehrseite: hoher Ressourcenverbrauch (Wasser, Ackerland etc.), Umweltverschmutzung durch Chemikalien (z. B. Pestizide, Dünge- und Färbemittel) und CO₂-Emissionen. Der Textilsektor verursacht weltweit etwa 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Die Schweiz setzt seit Jahrzehnten auf eine separate Sammlung von Alttextilien, um diese wiederzuverwenden oder zu recyceln. Es gibt jedoch Verbesserungspotenzial.
100’000 Tonnen Alttextilien pro Jahr
Allein in der Schweiz fallen jährlich rund 100’000 Tonnen Alttextilien an. Davon werden rund 60’000 Tonnen separat gesammelt. Sammelorganisationen wie Texaid, Tell Tex oder Caritas stellen dazu in den Gemeinden Sammelcontainer auf. Der Rest landet in der Kehrichtverbrennung und wird so mit Energierückgewinnung thermisch verwertet.
Die separat gesammelten Textilien werden fast ausschliesslich im Ausland sortiert. Etwa 60 Prozent (rund 36’000 Tonnen) sind noch tragbar und werden als Secondhandkleidung weiterverwendet. Weitere 28 Prozent landen in der stofflichen Verwertung und werden beispielsweise als Putzlappen oder Dämmstoffe in der Bauindustrie eingesetzt. Nur ein kleiner Teil (weniger als 1 Prozent) wird tatsächlich zu neuem Garn verarbeitet. Der verbleibende Rest – rund 12 Prozent – ist nicht mehr brauchbar und wird vernichtet (siehe Abbildung).
60 Prozent der gesammelten Alttextilien können noch getragen werden
INTERAKTIVE GRAFIK
Insbesondere bei jüngeren Personen liegt Secondhand im Trend. Neben klassischen Brockenhäusern und Flohmärkten erfreuen sich auch Kleidertauschbörsen und Onlineplattformen wachsender Beliebtheit. Der Nachhaltigkeitsaspekt von Secondhandkleidung ist für die Jugendlichen ein immer wichtigeres Kaufargument. Trotz dieses Trends übersteigt das Angebot an gebrauchter Kleidung in der Schweiz jedoch deutlich die Nachfrage. Viele gut erhaltene Stücke bleiben liegen oder werden ins Ausland exportiert.
Mechanisches Recycling nur begrenzt möglich
Nicht mehr tragbare Textilien landen meist im mechanischen Recycling. Dabei werden sie im Ausland in sogenannten Reissanlagen in ihre Fasern zerlegt. Diese können, je nach Material und Qualität, zu neuem Garn versponnen oder als Dämm- beziehungsweise Vliesmaterial in der Bauindustrie eingesetzt werden. Doch das Verfahren hat auch seine Grenzen: Die Fasern werden bei jedem Reissvorgang kürzer und verlieren an Qualität. Eine unendliche Wiederverwendung ist damit nicht möglich – und für bestimmte Gewebearten eignet sich das Verfahren kaum.
In der Schweiz gibt es bislang keine Reissanlage. Etwa 15 Prozent der Schweizer Alttextilien werden im Ausland auf diese Weise verarbeitet. Die Branche zeigt jedoch reges Interesse daran, eine Reissanlage im Inland aufzubauen, um die Wertschöpfung in der Schweiz zu erwirtschaften und um die Kontrolle über die Ressourcen zurückzugewinnen. Heute ist es nämlich so, dass nach der Sortierung oft unklar bleibt, wohin die Textilien tatsächlich gelangen und was letztlich mit ihnen geschieht.
Chemisches Recycling: Hoffnungsträger mit Risiken
Ein relativ neuer, aber vielversprechender Ansatz ist das chemische Recycling. Hierbei werden Textilien auf molekularer Ebene zerlegt und in neuwertige Fasern umgewandelt. Besonders für Mischgewebe wie Baumwolle-Polyester bietet dieses Verfahren neue Möglichkeiten – bisher galten diese als schwer recycelbar.
In der Schweiz laufen derzeit Pilotprojekte für solche Technologien. Start-ups und etablierte Unternehmen forschen intensiv an marktfähigen Lösungen. Allerdings stehen viele Verfahren noch am Anfang: Nicht alle Materialien lassen sich chemisch recyceln, und der Energie- sowie Chemikalieneinsatz ist hoch. Die Umweltverträglichkeit und die Effizienz solcher Verfahren müssen noch kritisch geprüft und mit einer Ökobilanz über den gesamten Lebenszyklus der Produkte nachgewiesen werden.
Fehlende Sortierung als Knackpunkt
Ein entscheidender Engpass liegt in der unzureichenden Sortierung der Alttextilien. Derzeit fehlen in der Schweiz automatisierte Anlagen, die Materialien zuverlässig nach Zusammensetzung und Qualität trennen können. Eine solche Infrastruktur wäre jedoch essenziell, um hochwertiges Recycling – ob mechanisch oder chemisch – überhaupt zu ermöglichen.
Zudem würde eine Sortieranlage im Inland die Transparenz in den Entsorgungswegen erhöhen und Arbeitsplätze sowie Innovation fördern. Durch eine inländische Sortierung liesse sich genau nachverfolgen, welche Mengen an Textilien in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, weiterverwendet oder entsorgt werden. So wäre nachvollziehbar, wo die Materialien verbleiben, anstatt dass sie – wie bisher – nach der Sortierung ins Ausland gelangen, wo oft unklar ist, ob sie tatsächlich recycelt, verbrannt oder als Secondhandware weiterverkauft werden. Auch für die Umwelt wäre das ein Gewinn: Nicht verwertbare Textilien könnten gezielter und umweltgerechter entsorgt werden. Zurzeit ist die Sammelorganisation Tell Tex daran, eine Sortieranlage in der Schweiz aufzubauen.
Auch international gewinnt das Thema Textilrecycling an Bedeutung. Die Europäische Union plant, verbindliche Quoten einzuführen, wie viel Recyclingmaterialien künftig in neuen Textilprodukten eingesetzt werden müssen. Das könnte die Nachfrage nach Recyclingfasern massiv ankurbeln – und auch der Schweizer Recyclingindustrie neue Impulse geben. Bislang ist der Markt für recycelte Fasern noch klein. Doch mit wachsenden regulatorischen Anforderungen und zunehmendem Bewusstsein in der Bevölkerung dürfte sich das bald ändern.
Der Weg in die Zukunft
Fest steht: Die Textilbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Schweiz hat mit ihrem bewährten Sammelsystem eine gute Ausgangslage; doch um die Stoffkreisläufe tatsächlich zu schliessen, braucht es mehr. Neben technologischen Innovationen ist auch ein verändertes Konsumverhalten gefragt. Statt kurzfristigen Modetrends zu folgen oder gar Billigmode zu kaufen, sollte Wert auf langlebige Produkte mit Reparaturmöglichkeiten sowie möglichst wiederverwendbare Kleidung mit fairen Herstellungsbedingungen gelegt werden. Zudem sollte man sich vor dem Kauf auch fragen: Ist ein neues Kleidungsstück wirklich nötig? Weiter sollte der Fokus auf guter Qualität liegen. So werden Ressourcen geschont und Abfall reduziert.
Gleichzeitig müssen auch die Hersteller bereits bei der Produktion darauf achten, dass ihre Produkte recyclingfähig sind und möglichst einfach verwertet werden können. Eine Zukunft mit widerstandsfähigen, mehrfach nutzbaren und recycelbaren Textilien ist machbar – sie erfordert jedoch ein grundlegendes Umdenken des Einzelnen und der Gesellschaft. Nur so lassen sich die negativen Auswirkungen der Textilindustrie verringern und der Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft ebnen.
Literaturverzeichnis
- Bundesrat (2025). Verwertung gebrauchter Textilien in der Schweiz. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postualts 22.3915 Nordmann vom 14. September 2022. Bern, 16. April.
- Quantis (2024). Stoffströme von Alttextilien in der Schweiz. Studie im Auftrag des Bundesamts für Umwelt. 8.3. 2024.
Bibliographie
- Bundesrat (2025). Verwertung gebrauchter Textilien in der Schweiz. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postualts 22.3915 Nordmann vom 14. September 2022. Bern, 16. April.
- Quantis (2024). Stoffströme von Alttextilien in der Schweiz. Studie im Auftrag des Bundesamts für Umwelt. 8.3. 2024.
Zitiervorschlag: Rotzetter, Cornélia (2025). Nachhaltige Textilien: Hoffnungsträger und Knackpunkte. Die Volkswirtschaft, 14. November.