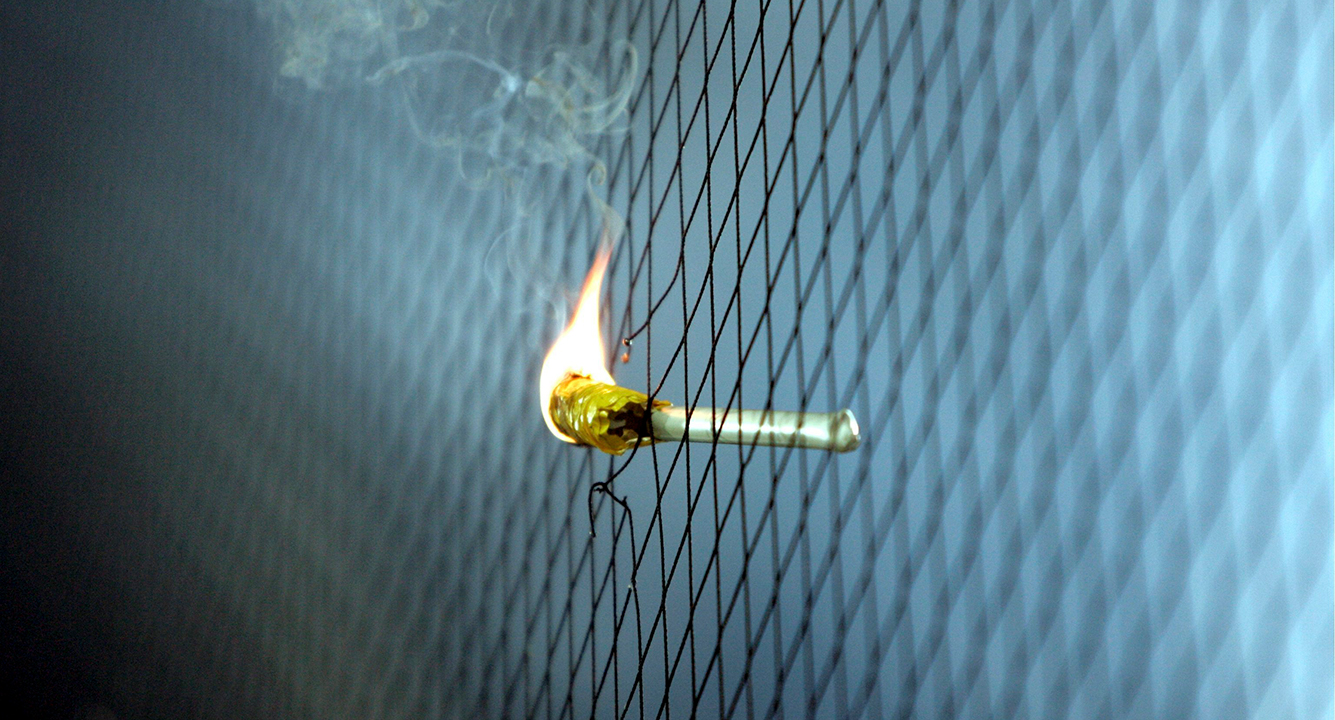Online lügt man leichter

Menschen betrügen dreimal so häufig, wenn sie mit einer Maschine statt mit einem Menschen interagieren. (Bild: Keystone)
Internet, E-Mail und soziale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Teamkolleginnen arbeiten miteinander, ohne physisch am selben Ort zu sein, Händler verkaufen ihre Produkte zunehmend online[1]. Dabei opfern wir häufig die direkte menschliche Interaktion, wie sie bei traditioneller Kommunikation wie einem Telefongespräch oder einem Treffen stattfindet. Was macht das mit unserer Ehrlichkeit? Eine Studie der Universität Zürich untersucht, ob wir häufiger betrügen, wenn wir mit einer Maschine statt mit einem Menschen kommunizieren.[2]
Hierfür wurde eine Reihe von Experimenten mit insgesamt 848 Teilnehmenden durchgeführt. Alle Teilnehmenden warfen je zehnmal eine Münze, ohne dass sie jemand dabei beobachtete. Für jeden Münzwurf konnten sie zwei Franken gewinnen, je nachdem, ob das Ergebnis Kopf oder Zahl war. Ihre Ergebnisse – also die Anzahl erfolgreicher Münzwürfe – mussten sie auf unterschiedlichen Kanälen dem Versuchsleiter mitteilen. Wenn sie dabei logen, konnten sie ihre Einnahmen um bis zu 20 Franken steigern. Da die Teilnehmenden ihre Würfe unbeobachtet durchführten, konnte niemand nachprüfen, ob sie die Wahrheit sagten. Doch gemäss Wahrscheinlichkeitstheorie sollten die Teilnehmenden im Durchschnitt fünf erfolgreiche Münzwürfe erzielen, also 50 Prozent.
Ablauf des Experiments
Die Versuche unterschieden sich in der Art, wie die Teilnehmenden die Ergebnisse meldeten: entweder einer Person oder einer Maschine und entweder schriftlich oder mündlich. Die erste Gruppe übermittelte die Anzahl erfolgreicher Münzwürfe via Skype-Anruf ohne Video an den Versuchsleiter. Die zweite Gruppe schickte sie über ein nicht interaktives Onlineformular, während die dritte Gruppe sie schriftlich mittels Chat über Skype-Instant-Messaging direkt dem Versuchsleiter schickte. Die vierte und letzte Gruppe interagierte mit einem automatisierten Sprachsystem, das sie mit vorab aufgezeichneten Sprachbotschaften des Versuchsleiters aufforderte, ihre Ergebnisse zu melden.
Alle Gruppen führten das Experiment unter denselben Bedingungen durch. Insbesondere waren alle informiert, dass keine weiteren Fragen zu den Ergebnissen gestellt werden, und es bestand kein Zeitdruck. Das Risiko, für Betrug bestraft zu werden, war in allen Gruppen gleich null. Unterschiedliche Ergebnisse lassen sich somit damit begründen, über welchen Kanal sie gemeldet wurden.
Im Kontakt mit Menschen ehrlicher
In den Experimenten zeigte sich, dass Teilnehmende, die ihre Resultate via Skype-Anruf einem Menschen mitteilten, nur wenig schummelten: Sie meldeten durchschnittlich 54 Prozent erfolgreiche Münzwürfe (siehe Abbildung). Das entspricht einer Betrugsquote von 7,6 Prozent. Jene Gruppe, die die Ergebnisse via Chat mitteilte, meldete durchschnittlich 55,9 Prozent erfolgreiche Münzwürfe und war damit ähnlich ehrlich wie die Teilnehmenden, die ihre Ergebnisse telefonisch rapportierten.
Unterschiede zeigen sich bei der Gruppe, die mit dem automatisierten Sprachsystem kommunizierte. Da waren es im Durchschnitt 60,1 Prozent gemeldete erfolgreiche Münzwürfe. Nur beim Onlineformular war der angegebene Erfolg mit durchschnittlich 62 Prozent noch höher. Das entspricht einer Betrugsrate von 23,4 Prozent. Menschen betrügen also dreimal so häufig, wenn sie mit einer Maschine statt mit einem Menschen interagieren. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob die Stimme der Maschine menschlich ist wie beim automatisierten Sprachsystem.
Bei telefonischem Kontakt mit einem Menschen logen die Studienteilnehmenden am wenigsten häufig (2013)
INTERAKTIVE GRAFIK
Menschen wollen soziales Image wahren
Wie lässt sich das erklären? Die Verhaltensökonomie zeigt, dass Menschen Wert darauf legen, was andere von ihnen denken, und oft dadurch motiviert werden, ein bestimmtes soziales Image zu wahren. Wenn es keinen menschlichen Gegenpart gibt, ist es Menschen weniger wichtig, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Beim Experiment mit dem Chat gibt es zwar auch keinen direkten menschlichen Gegenpart, jedoch reicht das Gefühl aus, dass man direkt mit einem Menschen interagiert.
Die Studie weist darauf hin, dass der Einsatz von Maschinen und Robotern als Ersatz für Menschen ehrliches Verhalten untergraben kann. Das kann auch erklären, warum Betrug in der digitalen Welt so verbreitet ist. Schadprogramme wie Trojaner spähen anonym Passwörter oder Bankdaten aus. Bots testen gestohlene Log-in- oder Kreditkartendaten automatisch auf Hunderten Plattformen. Die dahinterstehenden Betrüger müssen nie mit den Geschädigten in Kontakt treten, um Informationen zu bekommen. Das macht es einfacher zu betrügen.
Andererseits kann Digitalisierung die Ehrlichkeit auch erhöhen. Machine-Learning, neue Verifizierungstechnologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz können Betrug entgegenwirken, weil er in Zukunft besser aufgedeckt werden kann. Und wenn herauskommt, dass man betrügt, ist das soziale Image wiederum gefährdet und der Anreiz höher, ehrlich zu sein.
Wer betrügt, wählt eher den digitalen Weg
Eine weitere gute Nachricht: Es ist möglich, unehrliche Menschen zu entlarven. In einem zweiten Experiment mit neuen Teilnehmenden wurde die Ehrlichkeit mittels Münzwurf ermittelt. Anschliessend konnten sie bei weiteren zehn Würfen selbst wählen, auf welchem Weg sie ihre Ergebnisse mitteilen wollten: entweder mittels Onlineformular oder mit einem Anruf beim Versuchsleiter.
Teilnehmende, die tendenziell unehrlicher sind, wählten eher den Kommunikationskanal ohne Mensch, bei dem sie sich weniger um ihr soziales Image kümmern müssen. Diese Erkenntnis eröffnet neue Möglichkeiten zur Erkennung von Betrugsrisiken. Zum Beispiel können Versicherungen ihre Ressourcen zur Betrugserkennung effektiver einsetzen, indem sie eher Fälle anschauen, bei denen mutmassliche Geschädigte ihre Angaben mittels Onlineformular erfassten, und solche, die sich mit einem Versicherungsmitarbeitenden trafen, aussen vor lassen.
Zitiervorschlag: Maréchal, Michel (2025). Online lügt man leichter. Die Volkswirtschaft, 10. November.