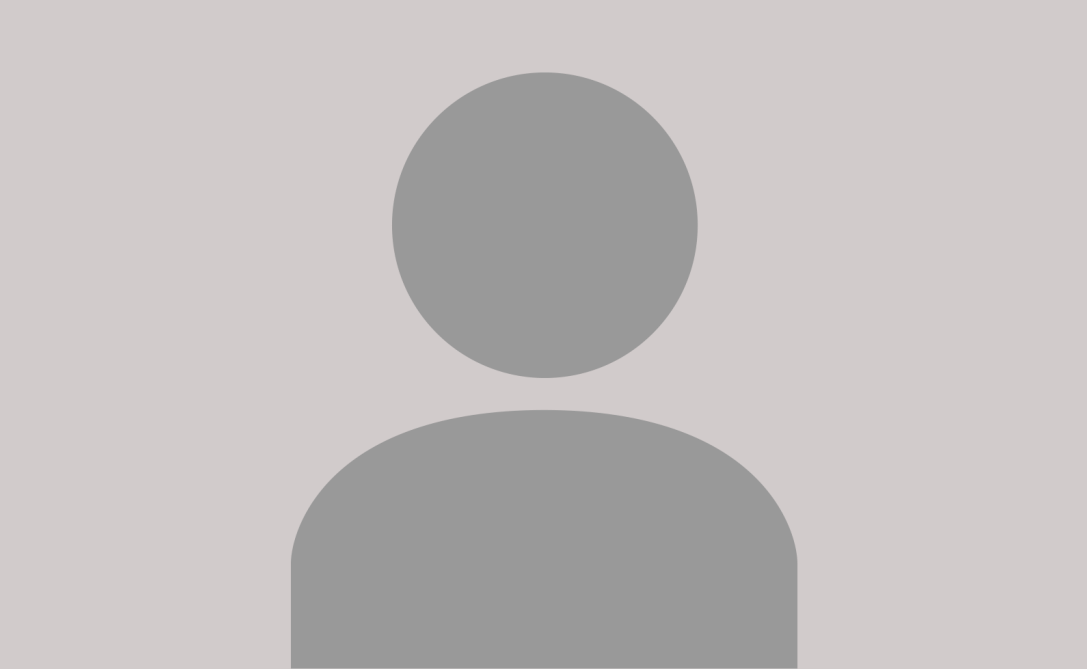Determinanten der Innovationstätigkeit – Ergebnisse ländervergleichender OECD-Studien
Innovation ist ein zentrales wirtschaftspolitisches Anliegen, bringt sie doch langfristig grössere Wachstumsmöglichkeiten. In einer Reihe von Studien haben die Autoren die Hauptdeterminanten der Innovation identifiziert. Dabei stützten sie sich auf empirische Daten von rund 20 OECD-Ländern, die sich über den Zeitraum von 1982 bis 2001 erstrecken. Die Studien zeigen, dass die Rahmenbedingungen (Wettbewerb, internationale Öffnung und Verfügbarkeit von Finanzmitteln) mindestens so wichtig sind wie die eigentliche Innovationspolitik, das heisst die Förderung der privaten Forschung, die Finanzierung der Grundlagenforschung, die Begünstigung des Wissenstransfers zwischen Hochschulen und Unternehmen sowie die Sicherstellung einer qualitativ ausgewiesenen Hochschulbildung. 
Mit der Lissabonner Strategie hat sich die Europäische Union (EU) das Ziel gesetzt, das europäische Wachstum zu dynamisieren. In diesem Kontext sollen die EU-Mitgliedsländer ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) bis 2010 auf 3% des Bruttoinlandprodukts (BIP) anheben. Andere Länder verfolgen ähnliche Ziele. Innovation ist aber ein Konzept, das weit über den Rahmen der F&E-Ausgaben hinausreicht. Rein technisch betrachtet ist Innovation die Einführung eines neuen oder zumindest deutlich verbesserten Produkts oder Verfahrens. F&E-Aktivitäten, Patentanmeldungen oder die Nutzung anderer Schutzmechanismen für Erfindungen bilden Zwischenstufen des Innovationsprozesses und führen nicht unbedingt zur Einführung neuer Produkte oder Verfahren. Zur Innovation gehört auch die Übernahme von im Ausland realisierten Erfindungen, was nicht in der inländischen F&E- bzw. Patentstatistik erscheint. Die jüngste Innovationsforschung hat zur Entwicklung neuer, umfassenderer Indikatoren geführt, die einen stärkeren Bezug zum Endprodukt der Innovation aufweisen. Die neuen Studien erweitern die Messung der Innovationsinputs und des Erfinderschutzes. Sie berücksichtigen neben der F&E auch den für Innovationszwecke notwendigen Erwerb von Spezialmaschinen sowie die Ausbildung und den Beizug von Fremdwissen. Zudem liefern sie Daten zum Anteil von Unternehmen, die ein neues Produkt oder Verfahren eingeführt haben, sowie zum Anteil neuer Produkte am Umsatz der betreffenden Unternehmen. Diese Messungen sind allerdings mit gewissen Unzulänglichkeiten behaftet, da die Neuartigkeit eines Produkts oder Verfahrens der Einschätzung des Unternehmens selbst überlassen ist – eine Einschätzung, die überdies von kulturellen Unterschieden beeinflusst wird. Immerhin geht aus der OECD-Studie hervor, dass eine enge Beziehung zwischen F&E, Patentanmeldungen und Innovation besteht. Zu den innovativsten Ländern gehören Schweden, Finnland, Japan, die USA und die Schweiz (vgl. Grafiken 1 und 2).
Günstige Rahmenbedingungen für Innovation
Eine rege Innovationstätigkeit geht häufig einher mit kräftigem Wirtschaftswachstum, geringer Inflation, einem realen Wechselkurs, der eine gute Wettbewerbsfähigkeit widerspiegelt, sowie mit niedrigen Realzinsen. Letztere haben einen direkten Einfluss auf die (Opportunitäts-)Kosten für F&E-Ausgaben. Ein Vergleich von Innovationsleistungen und Politik der OECD-Länder lässt erkennen, dass auch andere Faktoren von entscheidender Bedeutung sind – insbesondere Wettbewerb, internationale Öffnung und Zugang zu Kapital.
Wettbewerb und Innovation
In der Theorie ist die Beziehung zwischen Wettbewerb und Innovation ambivalent. Ein Unternehmen ist innovativ, um sich von der Konkurrenz abzuheben oder ihr zuvorzukommen. Bei sehr intensivem Wettbewerb kann die potenzielle Innovationsrendite allerdings derart gering sein, dass sich eine Investition in F&E nicht mehr lohnt; abgesehen davon schmälert der Wettbewerb die Margen und damit die zur Finanzierung von Innovationen verfügbaren Eigenmittel. In der Praxis hat der Wettbewerb aber einen klar positiven Effekt auf die Innovation – unabhängig davon, ob die Wirkung auf F&E, auf Patentanmeldungen oder auf den Anteil innovativer Unternehmen gemessen wird.1 Die schwache Produktmarktregulierung in Australien, den USA und Grossbritannien erhöht die F&E-Intensität um 10% gegen-über dem OECD-Durchschnitt.2 Die hier angegebenen %-Werte beziehen sich auf eine Skala, in der 100% dem OECD-Durchschnitt der F&E-Ausgaben entspricht. Die strenge Produktmarktregulierung in der Schweiz hingegen induziert – im Vergleich zum OECD-Mittel – eine um 5% niedrigere F&E-Intensität. Die Arbeitsmarktregulierung scheint sich ihrerseits eher auf die Art und weniger auf die Quantität der Innovationen auszuwirken. Bei einer geringen Flexibilität des Produktionsfaktors Arbeit neigen die Unternehmen zu mehr Verfahrensinnovationen, indem sie die spezifischen Kompetenzen ihrer Arbeitnehmer ausnutzen. Dies hat zwar keinen Einfluss auf die F&E-Ausgaben und den entsprechenden Anteil innovierender Firmen, schlägt sich aber in einer geringeren Zahl von Patentanmeldungen nieder, da Patente zum Schutz von Verfahrensinnovationen weniger geeignet sind.
Internationale Öffnung
Die internationale Öffnung verstärkt nicht nur den Wettbewerb auf den betroffenen Binnenmärkten, sondern ermöglicht auch den Zugang zu den im Ausland realisierten Erfindungen. Der Zugang kann verschiedene Formen annehmen – von der einfachen Informationsvermittlung, dem Güter- und Dienstleistungsaustausch sowie ausländischen Direktinvestitionen bis hin zur Mobilität der Forschenden. Aus der OECD-Studie geht hervor, dass ein Anstieg des im Ausland erschliessbaren Wissens die F&E-Ausgaben und die inländischen Patentanmeldungen stimuliert. Dieser Effekt ist umso stärker, je höher die Absorptionsfähigkeit in Bezug auf Fremdwissen – gemessen an der Anzahl Forschender im Bereich der inländischen F&E – ist.3 Für ein gegebenes Jahr errechnet sich der Vorrat an Fremdwissen als gewichtete Summe des F&E-Kapitalstocks der erfassten Länder, wobei die Gewichtung auf den Importen der beteiligten Länder beruht. Länder wie Belgien, Irland, die Niederlande und die Schweiz profitieren besonders von internationaler Öffnung.
Finanzierung – ein heikles Problem
Innovationen werden hauptsächlich mit Eigenkapital finanziert. Denn das damit verbundene hohe Risiko und die asymmetrische Informationsverteilung zwischen Kreditgebern und -nehmern machen die externe Finanzierung teuer. Die Aktienfinanzierung – insbesondere das Risikokapital – eignet sich am besten für Innovationen. Risikoinvestoren zeichnen sich zumeist durch ein grosses Fachwissen aus; dies verringert die Informationsasymmetrie und erlaubt den Investoren überdies, die Unternehmen zu beraten. Die OECD-Studie zeigt, dass die Innovationsleistung mit der Rentabilität der Unternehmen und der Höhe der Börsenkapitalisierung steigt; eine Zunahme des Risikokapitals geht mit abnehmenden Finanzierungsengpässen von Innovationen einher. Auf Grundlage dieser Indikatoren – und unter Ausschluss des Risikokapitals – gehören Norwegen, Grossbritannien und die Schweiz zu den Ländern mit den innovationsfreundlichsten Finanzierungsbedingungen. Die F&E-Intensität dieser Länder erhöht sich aus diesem Grund um mehr als 10%. Österreich und Dänemark weisen die ungünstigsten Finanzierungsbedingungen auf. Allerdings bewegt sich das Risikokapital in der Schweiz gegenüber den USA, Grossbritannien oder anderen europäischen Ländern auf einem bescheidenen Niveau.
Gestaltung eines innovationsfreundlichen Umfelds
Einige innovationspolitische Massnahmen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die OECD-Studien zeigen, dass die öffentliche Forschung ausserordentlich innovationsfördernd ist. Besonders die Grundlagenforschung ist eine bedeutende Quelle wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der den Unternehmen neue Möglichkeiten der angewandten Forschung eröffnet. Die Grundlagenforschung ist oft auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen, weil die kommerziellen Verwertungsmöglichkeiten ungewiss und erst nach geraumer Zeit erschliessbar sind. Der Nettoeffekt der öffentlichen Forschung auf die private F&E ist klar positiv, auch wenn ein gewisses Konkurrenzverhältnis zwischen öffentlicher und privater Forschung besteht. Das führt bei mehr öffentlicher Forschung zu einem tendenziell höheren Lohnniveau bei den Forschungskräften. In Schweden und Finnland, deren öffentliche Forschung um rund 25% über dem OECD-Mittel liegt, sind positive Wirkungen auf die F&E-Intensität der Privatwirtschaft auszumachen; die Schweiz bewegt sich bezüglich der öffentlichen Forschungstätigkeit im Durchschnittsbereich.
Verbesserte Effizienz der öffentlichen Forschung notwendig
Ein guter Austausch zwischen Wissenschaft und Unternehmen verbessert entscheidend die Wirkung der öffentlichen Forschung. Mehrere Länder haben die entsprechenden Initiativen verstärkt. So werden etwa die Universitäten dazu ermutigt, aktiver von ihren geistigen Eigentumsrechten Gebrauch zu machen. Viele Länder schaffen Stellen für den Technologietransfer, um die kommerzielle Verwertung ihrer Erfindungen zu begünstigen. Ausserdem versuchen zahlreiche Länder, die Kooperation zwischen den Universitäten und den Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren zu erhöhen, so etwa über die finanzielle Unterstützung von Kooperationsprojekten. In der Schweiz wird diese Aufgabe von der Förderagentur für Innovation KTI wahrgenommen. Die Beziehungen zwischen Universitäten und Unternehmen sind schwer messbar. Doch bestätigt die OECD-Studie anhand eines Teilindikators – dem Anteil der öffentlichen F&E, die durch den Privatsektor finanziert wird -, dass engere Beziehungen zwischen den Hochschulen und dem Privatsektor die Forschungsaktivität der Unternehmen tendenziell stimulieren.
Beschränkter Einfluss direkter Finanzbeihilfen
Die meisten Länder unterstützen die privaten Forschungsaktivitäten mit direkten Finanzierungshilfen in Form von Steueranreizen oder Subventionen. Dies mag aus theoretischer Sicht in bestimmten Fällen gerechtfertigt sein.4 Für ein gegebenes Jahr errechnet sich der Vorrat an Fremdwissen als gewichtete Summe des F&E-Kapitalstocks der erfassten Länder, wobei die Gewichtung auf den Importen der beteiligten Länder beruht. In der Praxis erweist sich die Bewertung der Effizienz dieser Beihilfen allerdings als problematisch. So ist eine positive Korrelation zwischen Direktsubventionen und F&E der Unternehmen nicht unbedingt auf die Förderung zurückzuführen, sondern kann vielmehr einfach die Tatsache widerspiegeln, dass die Behörden bevorzugt Unternehmen unterstützen, die bereits in F&E erfolgreich sind. Zudem ist bei der positiven Korrelation zwischen den Steueranreizen für Innovationen und der privaten Forschung zu berücksichtigen, dass die Unternehmen – zumindest teilweise – gewisse Ausgaben als Forschung deklarieren, um von den Steuerabzügen oder Steuerkrediten zu profitieren. Die OECD-Studie zeigt, dass die direkte Hilfe einen positiven, wenn auch meist eher bescheidenen Einfluss auf die private F&E hat. Dabei sind Steueranreize effizienter als Direktsubventionen; bei Unternehmen mit geringer Rentabilität steigt allerdings die Wirkung von Direktsubventionen. Zudem generieren sowohl Steueranreize wie auch Direktsubventionen öffentliche Kosten, die entweder durch Steuererhöhungen oder Ausgabensenkungen in anderen Bereichen finanziert werden müssen. Verschiedene Länder mit einem tiefen Niveau öffentlicher Direkthilfen – darunter auch die Schweiz – gehören zu den Ländern mit den höchsten F&E-Intensitätsraten.
Schutz des geistigen Eigentums
Die Rechte geistigen Eigentums (IPR) gelten als wichtiger Innovationsstimulus, da sie dem Innovator eine gewisse Aneignung seiner Innovation gewährleisten. Ausserdem begünstigen sie den Wissenstransfer und tragen somit zur Vermeidung doppelter Forschungsanstrengungen bei, da Forschende ihre Erfindungen sonst wohl geheim halten würden. Der Schutz der IPR hat sich tendenziell verstärkt; unter den OECD-Ländern lässt sich eine gewisse Konvergenz beobachten. Allerdings ist die Beziehung zwischen IPR und Innovation komplex. Ein übermässiger Schutz durch IPR kann die Nutzung von Wissen und den Zugang zu Forschungsinstrumenten blockieren und damit einer Innovation im Wege stehen. Das betrifft insbesondere Bereiche wie Biotechnologie und Informations- und Kommunikationstechnologie, wo der Forschungsprozess kumulativ ist. Die OECD-Studie stellt die Berechtigung der IPR nicht in Frage, unterstreicht aber, dass kontraproduktive Auswirkungen auftreten können, wenn der Schutz durch IPR zu weit geht. Eine Verstärkung der IPR erhöht zwar die Patentanmeldungen deutlich, jedoch kaum die F&E-Tätigkeit der Unternehmen. Mit anderen Worten: Die IPR motivieren die Unternehmen dazu, Patente anzumelden und/oder ihre Forschung auf Aktivitäten zu konzentrieren, die durch Patente geschützt werden; sie geben aber nur wenig Anreiz für eine Steigerung der Forschungsintensität. Ausserdem scheint eine Verstärkung der IPR die Effizienz der Forschen-den – möglicherweise aus den erwähnten Gründen – zu beeinträchtigen.
Verfügbare personelle Forschungskapazitäten
Die Personalkosten machen im Schnitt 50% der F&E-Ausgaben aus. Der OECD-Studie zufolge richtet sich das Angebot an Forschenden einerseits nach dem durchschnittlichen Ausbildungsniveau der Bevölkerung (je mehr Hochschulabsolventen, desto mehr Diplomierte in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen), andererseits nach dem Lohngefälle zwischen Diplomierten und Abgängern anderer Bildungsgänge. Länder mit besseren Lohnkonditionen für Wissenschafter ziehen mehr ausländische Forschende an und vermögen heimische Wissenschafter besser an sich zu binden. Grundsätzlich besteht keine Veranlassung, in die Marktmechanismen einzugreifen, um die Verfügbarkeit der Forschenden zu erhöhen. Es bleibt aber Aufgabe des Staates, für ein ausreichendes, effizientes und erstklassiges Bildungsangebot – ob öffentlich oder privat – zu sorgen. Da die Ausbildung zum Wissenschafter oder Ingenieur mindestens 4-5 Jahre dauert, reagiert das Angebot an Forschenden auf die Marktsignale – d.h. die Löhne – erst um mehrere Jahre verzögert. Somit besteht das Risiko, dass die zusätzlich in die Forschung fliessenden finanziellen Mittel anfänglich die Löhne der Forscher anheben, anstatt das Angebot an Forschern zu steigern. Die Möglichkeiten, die F&E-Intensität einer Volkswirtschaft rasch zu erhöhen, sind also begrenzt.
Kasten 1: Literaturhinweise – Jaumotte, F. and Pain, N. (2005): Innovation Policies: Innovation in the Business Sector, in: OECD Economics Department Working Paper, Paris (erscheint demnächst).- Jaumotte, F. and Pain, N. (2005): An Overview of Public Policies to Support Innovation, in: OECD Economics Department Working Paper, Paris (erscheint demnächst).- Jaumotte, F. and Pain, N. (2005): From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting, in: OECD Economics Department Working Paper, Paris (erscheint demnächst). – Jaumotte, F. and Pain, N. (2005): From Innovation Development to Implementation: Evidence from the Community Innovation Survey, in: OECD Economics Department Working Paper, Paris (erscheint demnächst).- OCDE (2003): Les sources de la croissance économique dans les pays de l’OCDE, Paris.
Zitiervorschlag: Florence Jaumotte, Nigel Pain, (2005). Determinanten der Innovationstätigkeit – Ergebnisse ländervergleichender OECD-Studien. Die Volkswirtschaft, 01. Dezember.
Das könnte Sie auch interessieren


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO