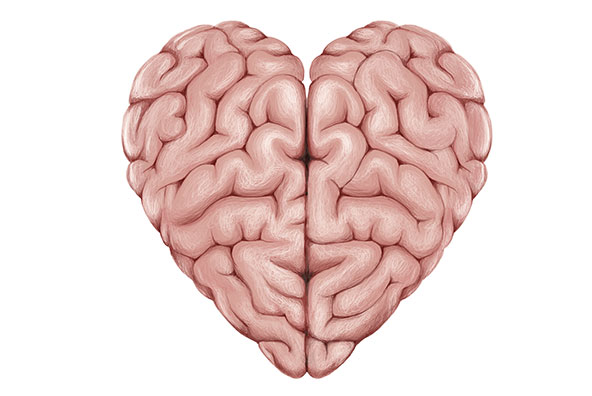Der Mensch handelt nicht immer rational – das ist eine zentrale Erkenntnis der Verhaltensökonomie. (Bild: Shutterstock)
Über lange Zeit wurde die wirtschaftswissenschaftliche Verhaltensforschung vom Menschenbild des Homo oeconomicus geprägt – einem zentralen Konzept aus der ökonomischen Standardtheorie. Der Homo oeconomicus ist ein rationaler Entscheidungsträger, der ausschliesslich seine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt.
Das traditionelle Modell hat zweifellos gewichtige Stärken. Zum einen basiert es auf wenigen, einfachen Annahmen und ist somit breit anwendbar. Diese Allgemeingültigkeit ist ein Vorteil der Ökonomie gegenüber anderen Sozialwissenschaften wie der Psychologie oder der Soziologie, in welchen Theorien oft stark kontextbezogen und schwierig zu verallgemeinern sind. Zum anderen vermag die Theorie des rationalen Eigennutzes in bestimmten Kontexten erstaunlich präzise Prognosen zu machen. Vernon Smith, einer der Pioniere der experimentellen Wirtschaftsforschung, hat zum Beispiel bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren mit Experimenten gezeigt, dass die Standardtheorie die Handelsgleichgewichte von kompetitiven Märkten erfolgreich und genau vorhersagen kann.
Die Voraussetzungen für die Verhaltensökonomie wurden gelegt, als sich Ökonomen vermehrt für strategische Interaktionen ausserhalb der klassischen Marktstrukturen zu interessieren begannen. In den Sechziger- und Siebzigerjahren gewann beispielsweise die Spieltheorie – ein mathematisches Konzept zur Analyse von strategischen Entscheidungen – an Bedeutung. In der Folge begannen kreative Ökonomen Anfang der Achtzigerjahre spieltheoretische Prognosen zu sozialer Interaktion anhand von Experimenten zu testen. Dadurch wurde bald klar, dass die traditionellen Annahmen der Rationalität und des Eigennutzes das menschliche Verhalten in strategischen Situationen nur unzureichend zu erklären vermögen.
Motiviert durch diese Diskrepanz zwischen beobachtetem Verhalten und den Prognosen der Standardtheorie, haben Verhaltensökonomen seit den späten Achtzigerjahren – anfangs gegen starke Widerstände in der eigenen Profession – versucht, die Wirtschaftstheorie so zu modifizieren, dass sie das tatsächliche menschliche Verhalten besser erklären und voraussagen kann. Oft stützten sie sich bei ihrer Arbeit auf bestehende Erkenntnissen aus Nachbardisziplinen wie der Psychologie, der Biologie, der Soziologie und der Neurowissenschaften.
Dabei ging es den meisten Verhaltensökonomen nie darum, das traditionelle Modell völlig zurückzuweisen. So gilt Eigennutz weiterhin als ein wichtiges Motiv für menschliches Handeln, und die meisten Verhaltensökonomen sind ebenfalls der Meinung, dass die Leute versuchen, ihre Entscheidungen möglichst rational zu fällen. Im Unterschied zu Anhängern der Standardtheorie haben sie aber eingesehen, dass neben dem Eigennutz auch andere Motive relevant sind und der Versuch, rational zu sein, manchmal auch scheitert.
Verlustaversion als ökonomischer Faktor
Die Verhaltensökonomie hat über die letzten drei Jahrzehnte eine Vielzahl von menschlichen Verhaltensweisen dokumentiert, die das Standardmodell nicht erklären kann. Ob wir als Menschen zufrieden sind oder nicht, hängt beispielsweise nicht so sehr davon ab, wie viel wir von etwas haben, sondern wie sehr sich der Stand der Dinge verändert hat. So sind Leute, die unerwartet reich werden, vorübergehend zufriedener als vorher. Im Gegensatz dazu sind Personen, die schon immer reich waren und sich daran gewöhnt sind, im Durchschnitt nicht enorm viel glücklicher als andere.
Es scheint, dass wir unsere Errungenschaften fortwährend mit sogenannten Referenzpunkten vergleichen. Während uns positive Überraschungen wie ein übererwartet hoher Bonus glücklich machen, dämpfen negative Überraschungen wie ein Aktienkurseinbruch unser Wohlbefinden. Interessanterweise gewichten wir in diesen Vergleichen die Verluste stärker als die Gewinne. In anderen Worten: Ein Verlust von 1000 Franken ärgert die meisten Menschen viel mehr, als sie ein Gewinn von 1000 Franken freut. Diese sogenannte Verlustaversion wurde zum ersten Mal von den Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky in den späten Siebzigerjahren dokumentiert und ist seither in zahlreichen Experimenten im Labor und im Feld immer wieder bestätigt worden.
Dass Menschen typischerweise in Vergleichen denken und Verluste unser Wohlbefinden stark beeinträchtigen, hat wichtige Implikationen für ökonomische Entscheidungen. So bringt die Verlustaversion die Leute dazu, Risiken zu vermeiden, selbst wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist. Ein typisches Beispiel sind Versicherungen für Mietwagen oder Elektronikgeräte. Weil Leute Verluste auf jeden Fall vermeiden möchten, sind sie bereit, enorm hohe Preise für solche Versicherungen zu zahlen, selbst wenn das objektive Risiko eines hohen Schadens gering ist. Hinzu kommt die Tendenz, kleine Wahrscheinlichkeiten massiv zu überschätzen.
Eine weitere Implikation von Verlustaversion ist, dass Konsumenten anfällig auf gewisse Verkaufstechniken werden. Lockvogel-Angebote, zum Beispiel, funktionieren, weil Leute es als Verlust empfinden, wenn sie das Produkt nicht erhalten. Sie sind deshalb gerne bereit, einen hohen Preis für ein alternatives Produkt zu bezahlen, wenn das ursprüngliche Angebot nicht mehr erhältlich ist. Das gleiche Prinzip erklärt, weshalb Autoverkäufer oft zuerst ein Modell mit allen möglichen Optionen zeigen: Danach empfindet der Käufer jedes fehlende Extra als Verlust.
Unfaire Lohnkürzungen
Eine weitere zentrale Erkenntnis der Verhaltensökonomie ist: Menschen weichen bei strategischen Entscheidungen oft von der Maximierung des Eigennutzes ab. Frühe Experimente von Verhaltensforschern wie Werner Güth, Richard Thaler oder Ernst Fehr haben überzeugend aufgezeigt, dass viele Leute bereit sind, andere Menschen für faires Handeln zu belohnen oder für unfaire Aktionen zu strafen – selbst wenn dies mit beträchtlichen Kosten für sie selber verbunden ist. Allerdings ist Fairness nicht allen Leuten gleich wichtig: Während einige Menschen bereit sind, viel in Kauf zu nehmen, um ein faires Ergebnis zu erzielen, gibt es auch eine beträchtliche Zahl von Leuten, die sich eher eigennützig verhalten. Zudem sinkt die Fairness, wenn man sich unbeobachtet fühlt – oder wenn man seinen Egoismus verschleiern kann.
Der Einbezug von sozialen Motiven in die Wirtschaftstheorie erlaubt es, empirische Phänomene zu erklären, die nicht im Einklang mit dem Standardmodell sind. So entlassen Arbeitgeber in Rezessionen eher Angestellte, als dass sie deren Löhne kürzen. Der Grund: Lohnkürzungen werden oft als unfair empfunden. Deshalb besteht die Gefahr, dass die Angestellten den Arbeitgeber bestrafen, indem sie ihre Arbeitsleistung reduzieren. Fairnessmotive können ebenfalls erklären, weshalb Leute bereit sind, soziale Normen durchzusetzen und gegen Verstösse vorzugehen. Beispiele sind Zivilcourage angesichts achtloser Abfallentsorgung in einem Park oder bei Belästigungen in der Öffentlichkeit. Umgekehrt sind Fremde, die sich nie wieder sehen werden, oft bereit, einander zu helfen. Denken wir an anonyme Spenden oder die Hilfe bei einem Unfall.
Soziale Motive können auch die Ausgestaltung von Verträgen und den Führungsstil von Vorgesetzten beeinflussen. In gemeinsamen Arbeiten mit Ernst Fehr und Oliver Hart zeigen wir auf, dass es – im Widerspruch zur Standardtheorie – Sinn macht, Verträge sehr unflexibel zu gestalten, weil dadurch Konflikte in Handelsbeziehungen verhindert werden können. In einer aktuellen Arbeit mit John Antonakis, Giovanna d’Adda und Roberto Weber haben wir den Effekt von Motivationsansprachen von Vorgesetzten analysiert. Dabei zeigte sich: Der Motivationsschub, der von einer charismatischen Ansprache an die Mitarbeitenden ausgeht, ist mit dem Effekt von finanziellen Anreizen vergleichbar.
Leben in der Gegenwart
Wichtig in der Verhaltensökonomie sind auch intertemporale Entscheidungen: Viele Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, haben nicht nur eine unmittelbare Auswirkung im Moment, sondern auch Konsequenzen in der Zukunft. Dies trifft für alle Arten von Investitionen zu (Finanzanlagen, Ausbildungen, Sicherheit), aber auch für viele Konsumentscheidungen (Rauschmittel, gesundes Essen). Die Standardtheorie besagt: Rationale Akteure wägen die unmittelbaren und zukünftigen Konsequenzen sorgfältig ab und treffen dann die optimale Entscheidung. Demgegenüber legen Arbeiten von Forschern wie David Laibson oder Matthew Rabin nahe, dass die meisten Menschen die langfristigen Auswirkungen gegenüber den unmittelbaren Folgen unterbewerten.
Die Übergewichtung der Gegenwart gegenüber der Zukunft erklärt viele problematische wirtschaftliche Verhaltensweisen. Beispiele sind die ungenügende Altersvorsorge in Ländern wie den USA, die Zunahme von Übergewicht, Drogensucht und Überschuldung. Indem Verhaltensökonomen die Ursachen von solchen Phänomenen identifizierten, war es möglich, gezielte Lösungsansätze wie «Nudges» oder «Defaults» zu entwickeln (siehe Kasten).
Abschliessend lässt sich sagen: Die Verhaltensökonomie hat durch den Einbezug von Einsichten aus Nachbardisziplinen das ökonomische Modell so erweitert und modifiziert, dass es das menschliche Verhalten in vielen relevanten Entscheidungsprozessen besser erklären und voraussagen kann. Ein realistisches Menschenbild ist notwendig, weil Ökonomen nur dann sinnvolle Analysen liefern und erfolgversprechende Interventionen vorschlagen können, wenn sie die Ursache von wirtschaftlichen Entwicklungen auf der Verhaltensebene verstehen.
Literaturverzeichnis
- Ariely, Dan (2009). Denken hilft zwar, nützt aber nichts: Warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb.
- Fehr, Ernst, Oliver Hart und Christian Zehnder (2011). Contracts as Reference Points—Experimental Evidence, in: American Economic Review, 101(2), 493–525.
- Kahneman, Daniel (2012). Schnelles Denken, langsames Denken, Siedler Verlag.
- Levitt, Steven und Stephen Dubner (2006). Freakonomics: Überraschende Antworten auf alltägliche Lebensfragen, Riemann Verlag.
- Thaler, Richard und Cass Sunstein (2009). Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstösst, Econ.
- Zehnder, Christian, Holger Herz und Jean-Philippe Bonardi (2017). A Productive Clash of Cultures: Injecting Economics into Leadership Research, in: Leadership Quarterly, 28(1), 65–85.
Bibliographie
- Ariely, Dan (2009). Denken hilft zwar, nützt aber nichts: Warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb.
- Fehr, Ernst, Oliver Hart und Christian Zehnder (2011). Contracts as Reference Points—Experimental Evidence, in: American Economic Review, 101(2), 493–525.
- Kahneman, Daniel (2012). Schnelles Denken, langsames Denken, Siedler Verlag.
- Levitt, Steven und Stephen Dubner (2006). Freakonomics: Überraschende Antworten auf alltägliche Lebensfragen, Riemann Verlag.
- Thaler, Richard und Cass Sunstein (2009). Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstösst, Econ.
- Zehnder, Christian, Holger Herz und Jean-Philippe Bonardi (2017). A Productive Clash of Cultures: Injecting Economics into Leadership Research, in: Leadership Quarterly, 28(1), 65–85.
Zitiervorschlag: Christian Zehnder (2018). Verhaltensökonomie revolutioniert die Wirtschaftsforschung. Die Volkswirtschaft, 24. September.
Nudge bedeutet auf Englisch «Stups». Darunter wird eine subtile Intervention verstanden, die Menschen dazu bringen soll, bessere Entscheidungen zu treffen, ohne ihre Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Ein einfaches Beispiel: Um Konsumenten zu ermuntern, gesünder zu essen, werden beim Dessertbuffet Früchte vor den Süssigkeiten platziert.
Defaults sind eine Form von Nudges. Darunter wird eine vorgegebene Standardoption verstanden. Die Idee ist, dass man Leuten bei gewissen Entscheidungen (zum Beispiel bei der Altersvorsorge) eine gute Standardoption vorgibt, weil es dann wahrscheinlicher ist, dass Leute diese Option wählen. Wichtig ist, dass dabei die Wahlfreiheit nicht eingeschränkt wird und die Option jederzeit geändert werden kann.
Das könnte Sie auch interessieren

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO