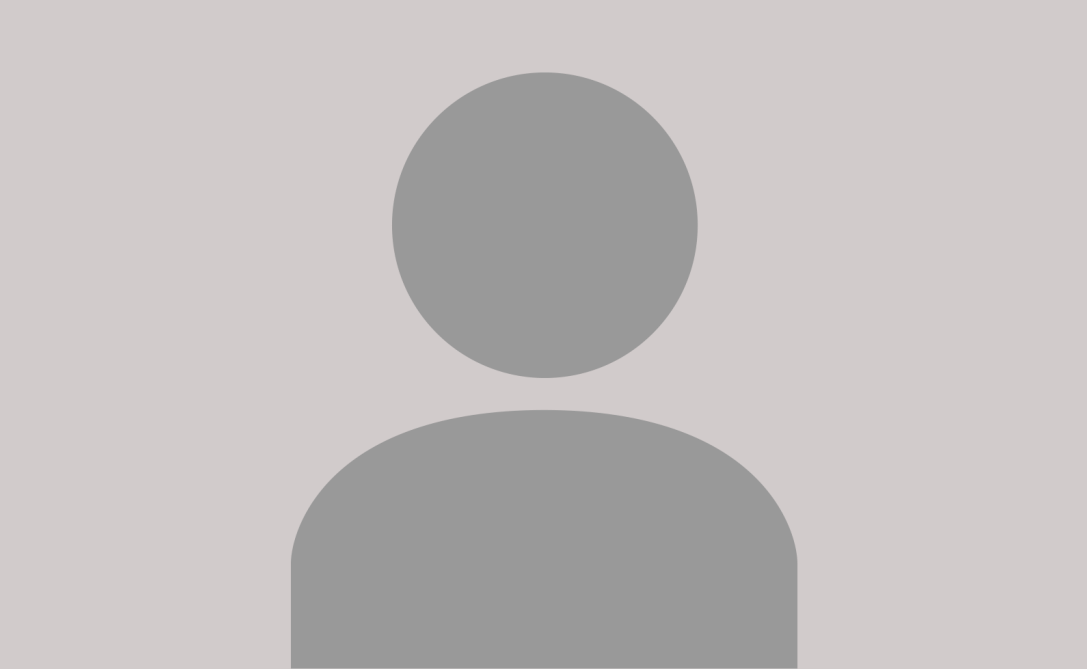Weltweit verfügen viele Menschen nach wie vor über keinen Trinkwasseranschluss. Wassertank in Bhopal, Indien. (Bild: Keystone)
Die Industriestaaten wenden rund 2 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes für den Wassersektor auf: Allein in den Erhalt der öffentlichen Trinkwasserinfrastruktur müssen in der Schweiz jedes Jahr über 900 Millionen Franken investiert werden. Sie sind nötig, um einwandfreie Wasserqualität, kontinuierliche Versorgung und die regelmässige Erneuerung und Instandhaltung der Anlagen dauerhaft zu gewährleisten. Finanziert werden diese Aufwendungen über die Gebühren der Nutzer (Haushalte, Gewerbe, Industrie etc.).
Während der grossen Privatisierungswelle von Telekommunikation, Strom- und Gasversorgung in den Neunzigerjahren kam auch die Wasserversorgung weltweit unter Beobachtung. Auffällige Defizite der kommunalen Betriebe waren in Europa zwar nicht auszumachen, dennoch förderte der ökonomische Zeitgeist mancherorts eine Privatisierung. In der EU spielten auch politische Vorgaben eine Rolle: Die Verschuldung der Kommunen sollte kurzfristig reduziert werden, um die Maastricht-Kriterien einzuhalten. In Osteuropa und in den Schwellenländern machten die internationalen Entwicklungsbanken und die Weltbank eine Privatisierung gar zur Bedingung für Kredite im Wassersektor.
Als Mutterland der Wasserprivatisierung kann Frankreich gelten. Viele französische Kommunen übertrugen bereits im frühen 20. Jahrhundert ihre Wasserversorgung an Privatunternehmen. Aus diesen Anfängen entwickelten sich grosse Versorgungskonzerne wie Suez und Veolia, die sich heute weltweit an Strom-, Gas-, Wasser-, Abfall-, Bau- und Verkehrsunternehmen beteiligen. Allerdings haben in jüngster Zeit zahlreiche französische Städte, etwa Paris und Bordeaux, ihre Wasserversorgung wieder in eigene Verantwortung zurückgeholt, allem voran wegen übermässig steigender Wasserpreise.
Zeche zahlen die Konsumenten
Auch in Deutschland fassten die französischen Versorger Fuss. 1999 verkaufte die Stadt Berlin aus Finanznot ihre Wasserversorgung für 3,3 Milliarden D-Mark zu 49,9 Prozent an ein Konsortium aus zwei Versorgern (Vivendi, RWE) und einem Versicherungskonzern (Allianz), wobei Vivendi die Betriebsführung übernahm. Schon bald erwies sich dies als heikles Geschäft für die Stadt, denn der (vertrauliche) Vertrag sah eine garantierte Rendite für die privaten Eigner vor. Die Preise stiegen, während die Investitionen für Ersatz und Instandhaltung der Infrastruktur unter das nötige Mass fielen. Ein Volksbegehren veranlasste die Stadt 2013 zum Rückkauf der privaten Anteile. Die Zeche für das Experiment zahlen die Konsumenten, denn die Kaufsumme von 1,2 Milliarden Euro wurde den Berliner Wasserbetrieben belastet, welche die Zinsen für 30 Jahre auf den Wasserpreis aufschlagen.
Die norddeutsche Küstenstadt Rostock holte nach Ablauf einer 25-jährigen Konzession an die Remondis-Tochter Eurawasser ihre Wasserversorgung 2018 wieder in eigene Regie zurück. Die Rekommunalisierung soll es erleichtern, den Herausforderungen des Klimawandels in der trockenen Region durch langfristige Kooperationen mit Nachbarversorgungen zu begegnen. Der Wasserpreis wurde um 24 Prozent gesenkt, Abwasser verbilligte sich um 14 Prozent. Für die Hamburger Wasserversorgung ist Eigenständigkeit gar Gesetz: In der Folge eines Volksbegehrens beschloss die Hansestadt 2006, ihre Wasserversorgung vollständig in öffentlichem Besitz zu behalten.
Altlasten aus der Ära Thatcher
Das weltweit radikalste Privatisierungsvorhaben wurde 1989 von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher verordnet. Anders als im sonst üblichen Modell befristeter Konzessionen liess sie sämtliche wasserwirtschaftlichen Anlagen in England und Wales an eigens gegründete Aktiengesellschaften übertragen – schuldenfrei und kostenlos. 30 Jahre später ist die Wasserversorgung in England hauptsächlich in den Händen von ausländischen Investmentgesellschaften, die über kein eigenes Branchen-Know-how verfügen.
Durch einen jahrzehntelangen Mangel an Erhaltungsinvestitionen gehören die Wasserverluste aus den vernachlässigten Rohrnetzen zu den höchsten in ganz Europa. Beim Londoner Versorger Thames Water etwa versickern rund 40 Prozent des eingespeisten Wassers: Pro Haushalt sind das 183 Liter pro Tag. Zum Vergleich: In der Schweiz beträgt der Wasserverlust 13 Prozent. Gleichzeitig ziehen die Eigentümer in England jährlich rund 2 Milliarden britische Pfund an Dividenden aus dem System. Dies schlägt sich mit 83 Pfund pro Haushalt nieder und macht mehr als 20 Prozent des Wasserpreises aus. Die Labour Party hat angekündigt, die Wasserversorgung wieder in öffentliche Verantwortung zurückholen zu wollen.
Weit komplexer als die Übernahme eines europäischen Wasserversorgers mit fertig gebauter Infrastruktur und zahlungskräftiger Bevölkerung ist das Wassermanagement von Megastädten in Schwellenländern. Wo Jahr für Jahr Zehntausende neue Haushalte hinzukommen und periurbane Armenviertel mit Wasser versorgt werden müssen, ist der Ausbau von Leitungsnetzen, Speichern, Pumpstationen und Aufbereitungsanlagen eine Herkulesaufgabe. In den Neunzigerjahren war es die feste Überzeugung der Weltbank, diese Aufgabe könne am besten unter privatwirtschaftlicher Ägide gemeistert werden. Doch die meisten damals verordneten Grossprivatisierungen wurden inzwischen rückgängig gemacht (zum Beispiel in Buenos Aires, in La Paz, in Maputo und in Daressalam). Die Gründe ähneln sich und können am Beispiel der indonesischen Hauptstadt Jakarta dargelegt werden – eines der weltweit grössten Ballungsräume.
Zum Beispiel Jakarta
Im Jahr 1997 schloss die Londoner Thames Water einen 25-jährigen Konzessionsvertrag für die Osthälfte Jakartas ab, die französische Lyonnaise des Eaux für die Westhälfte. Weniger als die Hälfte der damals 8 Millionen Einwohner verfügte über einen Wasseranschluss, und 61 Prozent des in die Netze gespeisten Wassers versickerten durch Leitungslecks oder wurden illegal abgezapft. Thames Water und Lyonnaise verpflichteten sich, binnen zehn Jahren 75 Prozent der Haushalte anzuschliessen und die Wasserverluste auf unter 25 Prozent zu reduzieren. Dafür wurde ihnen eine jährliche Rendite von 22 Prozent vertraglich garantiert.
Diese Ziele erwiesen sich schnell als illusorisch. Der Netzausbau und der Anschluss weiterer Haushalte gingen nur schleppend voran, und die Betreiber konnten die vereinbarte Rendite bei Weitem nicht erzielen. Bereits nach drei Jahren wurden deshalb die Verträge nachverhandelt: Die Ausbauziele wurden reduziert, die Rendite der Unternehmen gegen Wechselkursschwankungen, Zinserhöhungen und Inflation abgesichert. Die daraus resultierenden wesentlich höheren Forderungen der Betreiber waren nun nicht mehr durch die Wassergebühren der Haushalte zu decken. Die Differenz zahlte die staatliche Wassergesellschaft (als nominelle Eigentümerin der Infrastruktur), die so gewaltige Schulden anhäufte.
Gerichtshof schreitet ein
Diese Gemengelage – durch Staatsverschuldung gedeckte Renditen der privaten Betreiber bei kaum spürbaren Verbesserungen der Versorgungsqualität und steigenden Wasserpreisen – war politisch höchst unpopulär. Unter allen Grossstädten Indonesiens schneidet Jakarta heute mit nicht einmal 60 Prozent angeschlossenen Haushalten und Wasserverlusten von 44 Prozent am schlechtesten ab. Demgegenüber präsentiert sich die Situation in der zweitgrössten Stadt Surabaya, wo die Wasserversorgung in kommunaler Hand blieb, deutlich besser: 87 Prozent der Haushalte sind an das Wassernetz angeschlossen, und die Verluste liegen bei 34 Prozent. Da die vertraglich vereinbarten Ziele in Jakarta auch nach 20 Jahren nicht annähernd erreicht waren, erklärte der oberste Gerichtshof Indonesiens 2017 die Privatisierung für ungesetzlich. Im Februar 2019 leitete die Stadtverwaltung die Rekommunalisierung ein.
Weltweit befinden sich heute über 90 Prozent der Wasserversorgung in öffentlicher Verantwortung, Tendenz steigend. Die auf Wasser spezialisierten Unternehmen setzen heute überwiegend auf klar abgegrenzte Projekte wie Aufbereitungsanlagen oder Talsperren. Den wenig lukrativen Betrieb urbaner Wasserversorgungen überlassen sie wieder den Kommunen.
Zitiervorschlag: Klaus Lanz (2019). Die Privatisierung der Wasserversorgung hat sich nicht bewährt. Die Volkswirtschaft, 22. Mai.
Das könnte Sie auch interessieren

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO